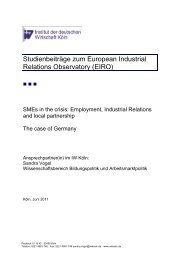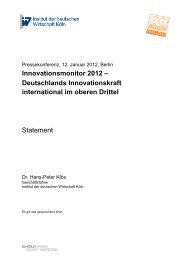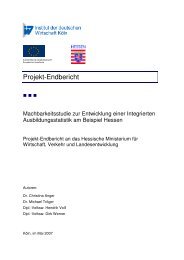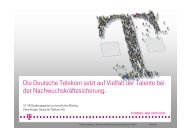Abschlussbericht - IW
Abschlussbericht - IW
Abschlussbericht - IW
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Institut der deutschen Wirtschaft Köln<br />
Unternehmer und Soziale Marktwirtschaft im Schulbuch<br />
________________________________________________________________________________________<br />
Sekundarstufe II<br />
Mensch und Raum Geographie 12 und 13, Gymnasiale Oberstufe, 1. Auflage 2001, 5.<br />
Druck 2008, 432 Seiten<br />
Das Buch ermöglicht auf 281 Seiten – das entspricht knapp zwei Drittel des gesamten Buchumfangs<br />
von 432 Seiten – Begegnungen mit wirtschaftsbezogenen und wirtschaftsgeographischen<br />
Themen. Dazu ist das Buch in drei Themenschwerpunkte gegliedert. Diese sind: „Leben in der<br />
Einen Welt“ (S. 16-129), „Entwicklungsprozesse in Stadt und Raum“ (S. 130-259) sowie „Globale<br />
Beziehungen und Betrachtungsweisen“ (S. 260-393). Insgesamt 29 ökonomische Schlüsselbegriffe<br />
des Analyserasters werden im Buch verwendet. Es gibt ein umfangreiches Register mit<br />
Begriffserklärungen (S. 420-430) mit etwa 440 Schlagworten; darunter befinden sich sieben<br />
Begriffe des Analyserasters, drei davon werden erklärt.<br />
In den so genannten „Geo-Bausteinen“ (S. 395-406), in denen geographisches Grundlagenwissen<br />
angeboten wird, das – so formulieren es die Autoren – „als Basis einzelner Kapitel in diesem<br />
Buch notwendig ist“ (S. 395), werden unter den Überschriften „Konkurrierende Wirtschaftsordnungen“<br />
(S. 402 f.) und „Vergleich der wichtigsten Wirtschaftsordnungen“ (S. 404) Grundzüge<br />
der liberalen bzw. freien Marktwirtschaft, der sozialen Marktwirtschaft sowie der Zentralverwaltungswirtschaft<br />
oder Plan- oder Kommandowirtschaft in plakativer Form dargelegt – oder<br />
vielmehr auf einige Schlüsselbegriffe reduziert. So lautet die Definition von „Preisbildung, Wettbewerb“<br />
(S. 404) unter dem Vorzeichen der liberalen Marktwirtschaft: „Preisbildung durch Angebot<br />
und Nachfrage, Wettbewerbsfreiheit“. Als Definition desselben Begriffspaares unter dem<br />
Vorzeichen der sozialen Marktwirtschaft ist zu lesen: „Preise als Ergebnisse des Wettbewerbs;<br />
Wettbewerbsfreiheit im Rahmen der sozialen Marktwirtschaft“. Dass diese Ausführungen nicht<br />
differenziert genug und damit nicht Erkenntnis leitend sind, ist offenkundig. Aber auch an keiner<br />
anderen Stelle des Buches stehen den Lernenden dazu vertiefende Informationen und Erklärungen<br />
zur Verfügung. Dieses Beispiel zeigt, worin das Grundproblem dieses Buches liegt. Einerseits<br />
ist es, was die thematische Vielfalt und das Anspruchsniveau betrifft, umfangreich und<br />
anspruchsvoll. Andererseits liefert es eben nicht die notwendigen originären Informationen und<br />
Erklärungen, die zum Aufbau eines ökonomischen Wissens und Verständnisses und damit zum<br />
Aufbau eines ökonomischen Referenzsystems gebraucht werden.<br />
Gerade weil mit einer Reihe von ökonomischen Begriffen hantiert wird, ergibt sich aus dem<br />
Mangel an (sachgerechter) Erklärung ein didaktisches Dilemma. Dies belegt auch das Beispiel<br />
der Verwendung des Begriffes des freien Marktes im Zusammenhang mit der Transformation<br />
Nicaraguas von einem sozialistischen hin zu einem neoliberalen System: „In den folgenden<br />
Jahren kam es zu einer starken Fluktuation, da viele Kleinbauern den Bedingungen des freien<br />
Marktes nicht gewachsen waren und ihr Land wegen Überschuldung verkaufen mussten“ (S.<br />
37). Merkmale eines freien Marktes werden – bis auf die hinter sechs Spiegelstrichen der Synopse<br />
„Vergleich der wichtigsten Wirtschaftsordnungen“ (S. 404) genannten Schlagwörter – nicht<br />
definiert. Das Fehlen basaler ökonomischer Begriffe bzw. deren Vermittlung, das zum Verständnis<br />
wirtschaftlicher Zusammenhänge vorauszusetzen ist, ist durchgängig feststellbar.<br />
Obwohl es – formal gesehen – auf 23 Seiten Hinweise zu Unternehmen gibt, bleibt das Buch<br />
detaillierte Antworten zu Funktionsweise und Rolle von Unternehmen als Akteure im Wirtschaftsprozess<br />
größtenteils schuldig. Dessen ungeachtet werden deutsche Unternehmen im<br />
Kontext der Globalisierung negativ konnotiert: „Siemens baut 6.000 deutsche Stellen ab (…)<br />
Gleichzeitig will der deutsche Elektroriese das Personal im Ausland bis zur Jahrtausendwende<br />
________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Abschlussbericht</strong> vom 11. Januar 2010 Seite 49 von 114