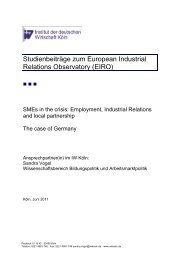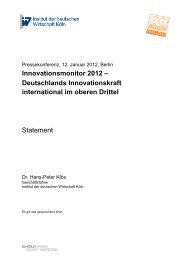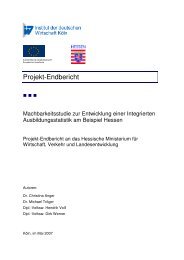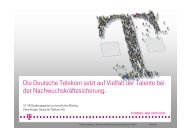Abschlussbericht - IW
Abschlussbericht - IW
Abschlussbericht - IW
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Institut der deutschen Wirtschaft Köln<br />
Unternehmer und Soziale Marktwirtschaft im Schulbuch<br />
________________________________________________________________________________________<br />
Themen abgebildet (Imperialismus, der Erste Weltkrieg, Weimarer Republik, Nationalsozialismus,<br />
Weltkonflikte – Ost-West, Nord-Süd und Nahost – Europa, Türkei sowie Deutschland nach<br />
1945). Dennoch leistet das Buch keinen Erkenntnisgewinn im Sinne der Fragestellung der Analyse.<br />
Insgesamt werden 17 ökonomische Schlüsselbegriffe des Analyserasters im Text genannt<br />
– doch weder werden diese in der notwendigen Weise erläutert noch dienen sie der Entwicklung<br />
eines ökonomischen Grundverständnisses.<br />
Bezeichnend für den aus wirtschaftsdidaktischer Sicht defizitären Zugang zur Sozialen Marktwirtschaft<br />
als Wirtschaftsordnung der Bundesrepublik Deutschland, der dem Buch immanent ist,<br />
ist das Kapitel „Deutschland im Westen: das Modell BRD – Fundamente: Grundgesetz und<br />
Marktwirtschaft – Wie soll die Wirtschaftsordnung des neuen Staates aussehen?“. Auf insgesamt<br />
vier Seiten präsentieren die Autoren beliebige Informationen zur Sozialen Marktwirtschaft.<br />
Deren Merkmale „freier Wettbewerb, freie Preisbildung auf der Grundlage von Privateigentum<br />
und Privatinitiative mit dem Ziel des „Wohlstands für alle““ erschließen sich aus einer der Fischer-Chronik<br />
Deutschland 1949-1999 entnommenen Quelle (S. 293). Dabei handelt es sich allerdings<br />
nur um eine Auflistung einzelner Wörter, ohne Zusammenhänge zu erläutern.<br />
Auch dem Schaubild „Marktwirtschaft“ ist keine Leseart zugeordnet und erschließt sich dem<br />
Lernenden nicht. Das Schaubild zeigt in seinem Zentrum eine Ellipse, die mit „Markt, Verträge,<br />
Angebot, Nachfrage, Preisbildung“ betextet ist. Dieses Gebilde verlassen sechs Pfeile, die mit<br />
„Industrie und Handwerk, Handel, Verkehr, Banken-Versicherungen, Landwirtschaft, Arbeitskräfte-Einkommen-Verbrauch-Haushalte“<br />
beschrieben sind und die in kreisförmigen Bögen zum<br />
„Markt“ zurückkehren. An fünf dieser Kreisbögen sind zwei weitere Piktogramme „Unternehmerische<br />
Eigenplanung“ und „Ergebniskontrolle“ angebracht. An der Seite ist ein Rechteck abgebildet,<br />
das mit „Staat“ überschrieben ist. Diese Art der Darstellung zielt scheinbar darauf ab, das<br />
Verhalten der Akteure einer Volkswirtschaft darzustellen. Doch wird es in dieser Aufgliederung<br />
den Funktionen der Akteure, insbesondere den Unternehmen, nicht gerecht. Überdies ergeben<br />
derlei Schemata wenig Sinn, wenn sie nicht in die Wirtschaftsordnung als Referenzsystem eingebunden<br />
sind.<br />
Der Mangel an einem ökonomischen Referenzsystem hat weit reichende Implikationen für das<br />
Entwickeln eines wirtschaftlichen Sachverstands und Problembewusstseins – auch an anderer<br />
Stelle. Beispielsweise wenn es darum geht, eine Internetrecherche zum Thema „Armut in Entwicklungsländern“<br />
(S. 235) durchzuführen. Ohne den Charakter der Wirtschaftsordnung, in der<br />
der Lernende lebt, zu verstehen – dies leistet das Buch nicht – wird er nur unzureichend wirtschaftliche<br />
und politische Sachverhalte beurteilen können. Das bloße Auflisten von endogenen<br />
und exogenen Faktoren zur Begründung von Unterentwicklung (S. 240 f.) reicht nicht aus, ökonomisches<br />
Fachwissen aufzubauen – von einer Bewertungskompetenz (siehe Fragestellung<br />
„Warum gibt es in Entwicklungsländern so viele arme Menschen?“) ganz zu schweigen.<br />
Im gesamten Buch finden sich keinerlei Hinweise zur Rolle und Funktion von Unternehmen,<br />
weder in den Jahren des Wiederaufbaus und „Wirtschaftswunders“ noch an anderer Stelle –<br />
wie etwa bei der Darstellung der 1970er und 1980er Jahre.<br />
Gesamtbefund: Die knappen Ausführungen zur Sozialen Marktwirtschaft sind zwar inhaltlich<br />
nicht zu beanstanden, doch sind sie in keiner Weise ausreichend. Das Unternehmertum als ö-<br />
konomisches und soziales Aktionszentrum ist völlig ausgeblendet. Eine Hinführung zu unternehmerischer<br />
Selbstständigkeit im Sinne der Entrepreneurship Education ist nicht gegeben. Ein<br />
________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Abschlussbericht</strong> vom 11. Januar 2010 Seite 56 von 114