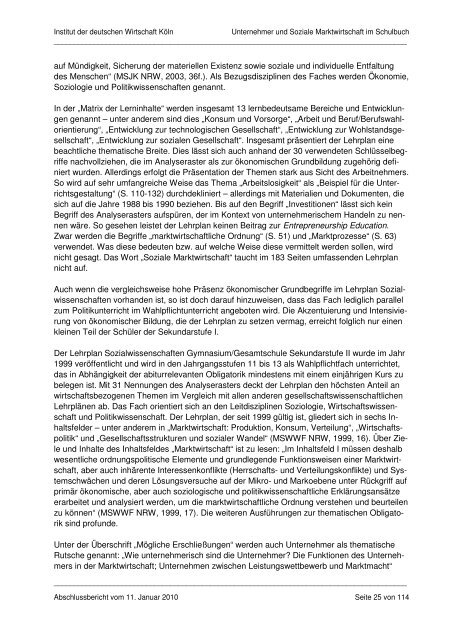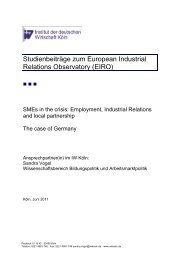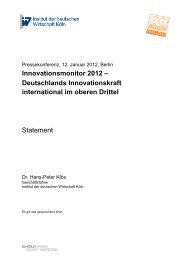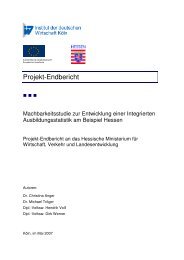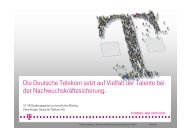Abschlussbericht - IW
Abschlussbericht - IW
Abschlussbericht - IW
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Institut der deutschen Wirtschaft Köln<br />
Unternehmer und Soziale Marktwirtschaft im Schulbuch<br />
________________________________________________________________________________________<br />
auf Mündigkeit, Sicherung der materiellen Existenz sowie soziale und individuelle Entfaltung<br />
des Menschen“ (MSJK NRW, 2003, 36f.). Als Bezugsdisziplinen des Faches werden Ökonomie,<br />
Soziologie und Politikwissenschaften genannt.<br />
In der „Matrix der Lerninhalte“ werden insgesamt 13 lernbedeutsame Bereiche und Entwicklungen<br />
genannt – unter anderem sind dies „Konsum und Vorsorge“, „Arbeit und Beruf/Berufswahlorientierung“,<br />
„Entwicklung zur technologischen Gesellschaft“, „Entwicklung zur Wohlstandsgesellschaft“,<br />
„Entwicklung zur sozialen Gesellschaft“. Insgesamt präsentiert der Lehrplan eine<br />
beachtliche thematische Breite. Dies lässt sich auch anhand der 30 verwendeten Schlüsselbegriffe<br />
nachvollziehen, die im Analyseraster als zur ökonomischen Grundbildung zugehörig definiert<br />
wurden. Allerdings erfolgt die Präsentation der Themen stark aus Sicht des Arbeitnehmers.<br />
So wird auf sehr umfangreiche Weise das Thema „Arbeitslosigkeit“ als „Beispiel für die Unterrichtsgestaltung“<br />
(S. 110-132) durchdekliniert – allerdings mit Materialien und Dokumenten, die<br />
sich auf die Jahre 1988 bis 1990 beziehen. Bis auf den Begriff „Investitionen“ lässt sich kein<br />
Begriff des Analyserasters aufspüren, der im Kontext von unternehmerischem Handeln zu nennen<br />
wäre. So gesehen leistet der Lehrplan keinen Beitrag zur Entrepreneurship Education.<br />
Zwar werden die Begriffe „marktwirtschaftliche Ordnung“ (S. 51) und „Marktprozesse“ (S. 63)<br />
verwendet. Was diese bedeuten bzw. auf welche Weise diese vermittelt werden sollen, wird<br />
nicht gesagt. Das Wort „Soziale Marktwirtschaft“ taucht im 183 Seiten umfassenden Lehrplan<br />
nicht auf.<br />
Auch wenn die vergleichsweise hohe Präsenz ökonomischer Grundbegriffe im Lehrplan Sozialwissenschaften<br />
vorhanden ist, so ist doch darauf hinzuweisen, dass das Fach lediglich parallel<br />
zum Politikunterricht im Wahlpflichtunterricht angeboten wird. Die Akzentuierung und Intensivierung<br />
von ökonomischer Bildung, die der Lehrplan zu setzen vermag, erreicht folglich nur einen<br />
kleinen Teil der Schüler der Sekundarstufe I.<br />
Der Lehrplan Sozialwissenschaften Gymnasium/Gesamtschule Sekundarstufe II wurde im Jahr<br />
1999 veröffentlicht und wird in den Jahrgangsstufen 11 bis 13 als Wahlpflichtfach unterrichtet,<br />
das in Abhängigkeit der abiturrelevanten Obligatorik mindestens mit einem einjährigen Kurs zu<br />
belegen ist. Mit 31 Nennungen des Analyserasters deckt der Lehrplan den höchsten Anteil an<br />
wirtschaftsbezogenen Themen im Vergleich mit allen anderen gesellschaftswissenschaftlichen<br />
Lehrplänen ab. Das Fach orientiert sich an den Leitdisziplinen Soziologie, Wirtschaftswissenschaft<br />
und Politikwissenschaft. Der Lehrplan, der seit 1999 gültig ist, gliedert sich in sechs Inhaltsfelder<br />
– unter anderem in „Marktwirtschaft: Produktion, Konsum, Verteilung“, „Wirtschaftspolitik“<br />
und „Gesellschaftsstrukturen und sozialer Wandel“ (MSWWF NRW, 1999, 16). Über Ziele<br />
und Inhalte des Inhaltsfeldes „Marktwirtschaft“ ist zu lesen: „Im Inhaltsfeld I müssen deshalb<br />
wesentliche ordnungspolitische Elemente und grundlegende Funktionsweisen einer Marktwirtschaft,<br />
aber auch inhärente Interessenkonflikte (Herrschafts- und Verteilungskonflikte) und Systemschwächen<br />
und deren Lösungsversuche auf der Mikro- und Markoebene unter Rückgriff auf<br />
primär ökonomische, aber auch soziologische und politikwissenschaftliche Erklärungsansätze<br />
erarbeitet und analysiert werden, um die marktwirtschaftliche Ordnung verstehen und beurteilen<br />
zu können“ (MSWWF NRW, 1999, 17). Die weiteren Ausführungen zur thematischen Obligatorik<br />
sind profunde.<br />
Unter der Überschrift „Mögliche Erschließungen“ werden auch Unternehmer als thematische<br />
Rutsche genannt: „Wie unternehmerisch sind die Unternehmer? Die Funktionen des Unternehmers<br />
in der Marktwirtschaft; Unternehmen zwischen Leistungswettbewerb und Marktmacht“<br />
________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Abschlussbericht</strong> vom 11. Januar 2010 Seite 25 von 114