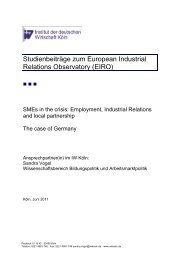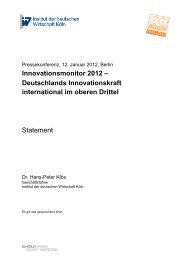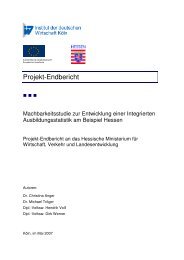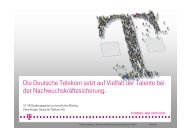Abschlussbericht - IW
Abschlussbericht - IW
Abschlussbericht - IW
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Institut der deutschen Wirtschaft Köln<br />
Unternehmer und Soziale Marktwirtschaft im Schulbuch<br />
________________________________________________________________________________________<br />
aus knapper Form vorhanden. Die Datenaktualität des Buches lässt sehr zu wünschen übrig.<br />
Eine Entrepreneurship Education als Teil der Wissensvermittlung ist nicht erkennbar.<br />
Wirtschaftspolitik, Kursthemen Sozialwissenschaften – Wirtschaftspolitik, Sekundarstufe<br />
II, Gymnasium, 1. Auflage 2003, 2. Druck 2006, Cornelsen Verlag, 338 Seiten<br />
Das Buch befasst sich auf 338 Seiten ausschließlich mit wirtschaftsbezogenen und wirtschaftspolitischen<br />
Themen. Nach Angaben des Autors baut es auf den „Kursthemen Sozialwissenschaften<br />
– Wirtschaft, Politik, Gesellschaft“ auf. Dessen Ziel ist es, wirtschaftspolitische<br />
Aspekte „in jenen fünf Dimensionen, die der Gesellschaft insgesamt und jeder/jedem Einzelnen<br />
heute auf den Nägeln brennen“ (S. 5), zu vertiefen. Genannt werden Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik,<br />
Modernisierungs- und Strukturpolitik (wird später als Wachstumspolitik bezeichnet),<br />
Umweltpolitik, Geldpolitik und Standortpolitik. Diesen „Dimensionen“ wird jeweils ein<br />
Buchkapitel gewidmet. Doch eine zielführende und sachgerechte Darstellung oder Problematisierung<br />
ist dabei nicht immer gegeben.<br />
Beim Kapitel „Beschäftigungspolitik“ (S. 38-99) fällt auf, dass auf 60 Seiten weithin Arbeitslosigkeit<br />
thematisiert wird: etwa anhand psychosozialer Folgen, der Kosten, und einer Typologie der<br />
Arbeitslosigkeit. Einen Eindruck davon vermittelt das Register. Dort werden allein unter dem<br />
Begriff Arbeitslosigkeit 37 Fundstellen genannt – werden Komposita hinzugenommen, sind es<br />
sogar 57 Nennungen. Den Lernenden wird in einem Workshop „Hearing: Was tun? Therapien<br />
gegen Arbeitslosigkeit“ (S. 79-97) die Möglichkeit gegeben, sich in Arbeitsgruppen mit unterschiedlichen<br />
Ursachen von Arbeitslosigkeit wie auch politischen Lösungsansätzen auseinanderzusetzen.<br />
Obwohl zehn Grafiken sowie eine Vielzahl an Quellentexten zur Arbeitslosigkeit<br />
angeboten werden, erschließt sich den Schülerinnen und Schülern nicht zwingend der hohe<br />
Ausprägungsgrad, den die strukturelle Arbeitslosigkeit auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland innehat.<br />
Insbesondere was die Plausibilität von arbeits(markt)politischem Handeln angeht, bietet<br />
das Material zu wenig zielführende Orientierung. Auch gibt es keinerlei Hinweise, welche Implikationen<br />
für die Bildungspolitik daraus abzuleiten wären.<br />
Eine disparate Quellenauswahl lässt sich auch an anderen Stellen entdecken. So werden unter<br />
der Überschrift „Nachfragesteuerung versus Angebotspolitik“ (S. 98) Aussagen aus Jahresgutachten<br />
des Sachverständigenrates zitiert, denen Positionen aus einem Memorandum der<br />
Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik gegenübergestellt werden. Die ausgewählten Texte<br />
lassen sich jedoch inhaltlich nicht unmittelbar aufeinander beziehen. Nicht nachvollziehbar ist,<br />
weshalb die Zitate des Sachverständigenrates aus den Gutachten der Jahre 1984/85, 1985/86<br />
und 1999/2000 stammen, die der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik aber aus dem<br />
Jahr 1997.<br />
Im Unterkapitel „Zu den Ursachen der systemischen Arbeitslosigkeit“ (S. 77 f.) präsentiert der<br />
Autor so genannte Argumentationskarten. Auf der Karte „Angebotsschwäche“ führt er aus: „Nur<br />
die Unternehmen können neue Arbeitsplätze schaffen. (…) Unternehmen investieren in der Absicht,<br />
mit den vorhandenen Sach- und Personalkapazitäten Güter zu produzieren, die auf den<br />
Märkten Erträge und Gewinne bringen. Wenn dies die Funktionsbedingungen privatwirtschaftlicher<br />
Wertschöpfung sind, dann dürfen die Unternehmen nicht blockiert werden – beispielsweise<br />
durch unflexible Arbeitsmärkte, durch eine (auch im internationalen Vergleich) überhöhte Steuer-<br />
und Abgabenbelastung, durch überzogene Regulierungen und Auflagen ...“ (S. 78). Doch<br />
die Antworten auf die sich hier stellenden Fragen, was „unflexible Arbeitsmärkte“ sind und wel-<br />
________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Abschlussbericht</strong> vom 11. Januar 2010 Seite 82 von 114