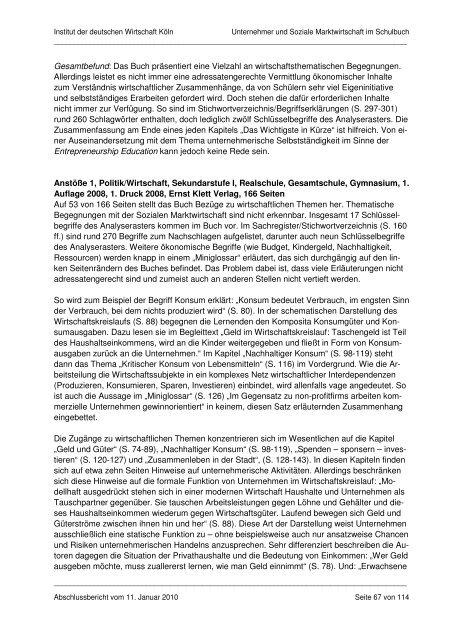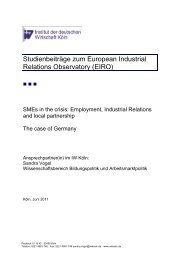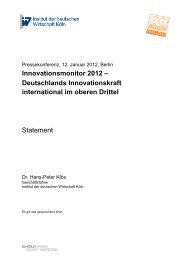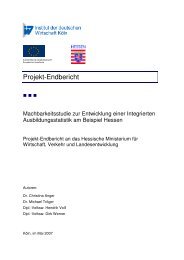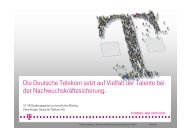Abschlussbericht - IW
Abschlussbericht - IW
Abschlussbericht - IW
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Institut der deutschen Wirtschaft Köln<br />
Unternehmer und Soziale Marktwirtschaft im Schulbuch<br />
________________________________________________________________________________________<br />
Gesamtbefund: Das Buch präsentiert eine Vielzahl an wirtschaftsthematischen Begegnungen.<br />
Allerdings leistet es nicht immer eine adressatengerechte Vermittlung ökonomischer Inhalte<br />
zum Verständnis wirtschaftlicher Zusammenhänge, da von Schülern sehr viel Eigeninitiative<br />
und selbstständiges Erarbeiten gefordert wird. Doch stehen die dafür erforderlichen Inhalte<br />
nicht immer zur Verfügung. So sind im Stichwortverzeichnis/Begriffserklärungen (S. 297-301)<br />
rund 260 Schlagwörter enthalten, doch lediglich zwölf Schlüsselbegriffe des Analyserasters. Die<br />
Zusammenfassung am Ende eines jeden Kapitels „Das Wichtigste in Kürze“ ist hilfreich. Von einer<br />
Auseinandersetzung mit dem Thema unternehmerische Selbstständigkeit im Sinne der<br />
Entrepreneurship Education kann jedoch keine Rede sein.<br />
Anstöße 1, Politik/Wirtschaft, Sekundarstufe I, Realschule, Gesamtschule, Gymnasium, 1.<br />
Auflage 2008, 1. Druck 2008, Ernst Klett Verlag, 166 Seiten<br />
Auf 53 von 166 Seiten stellt das Buch Bezüge zu wirtschaftlichen Themen her. Thematische<br />
Begegnungen mit der Sozialen Marktwirtschaft sind nicht erkennbar. Insgesamt 17 Schlüsselbegriffe<br />
des Analyserasters kommen im Buch vor. Im Sachregister/Stichwortverzeichnis (S. 160<br />
ff.) sind rund 270 Begriffe zum Nachschlagen aufgelistet, darunter auch neun Schlüsselbegriffe<br />
des Analyserasters. Weitere ökonomische Begriffe (wie Budget, Kindergeld, Nachhaltigkeit,<br />
Ressourcen) werden knapp in einem „Miniglossar“ erläutert, das sich durchgängig auf den linken<br />
Seitenrändern des Buches befindet. Das Problem dabei ist, dass viele Erläuterungen nicht<br />
adressatengerecht sind und zumeist auch an anderen Stellen nicht vertieft werden.<br />
So wird zum Beispiel der Begriff Konsum erklärt: „Konsum bedeutet Verbrauch, im engsten Sinn<br />
der Verbrauch, bei dem nichts produziert wird“ (S. 80). In der schematischen Darstellung des<br />
Wirtschaftskreislaufs (S. 88) begegnen die Lernenden den Komposita Konsumgüter und Konsumausgaben.<br />
Dazu lesen sie im Begleittext „Geld im Wirtschaftskreislauf: Taschengeld ist Teil<br />
des Haushaltseinkommens, wird an die Kinder weitergegeben und fließt in Form von Konsumausgaben<br />
zurück an die Unternehmen.“ Im Kapitel „Nachhaltiger Konsum“ (S. 98-119) steht<br />
dann das Thema „Kritischer Konsum von Lebensmitteln“ (S. 116) im Vordergrund. Wie die Arbeitsteilung<br />
die Wirtschaftssubjekte in ein komplexes Netz wirtschaftlicher Interdependenzen<br />
(Produzieren, Konsumieren, Sparen, Investieren) einbindet, wird allenfalls vage angedeutet. So<br />
ist auch die Aussage im „Miniglossar“ (S. 126) „Im Gegensatz zu non-profitfirms arbeiten kommerzielle<br />
Unternehmen gewinnorientiert“ in keinem, diesen Satz erläuternden Zusammenhang<br />
eingebettet.<br />
Die Zugänge zu wirtschaftlichen Themen konzentrieren sich im Wesentlichen auf die Kapitel<br />
„Geld und Güter“ (S. 74-89), „Nachhaltiger Konsum“ (S. 98-119), „Spenden – sponsern – investieren“<br />
(S. 120-127) und „Zusammenleben in der Stadt“, (S. 128-143). In diesen Kapiteln finden<br />
sich auf etwa zehn Seiten Hinweise auf unternehmerische Aktivitäten. Allerdings beschränken<br />
sich diese Hinweise auf die formale Funktion von Unternehmen im Wirtschaftskreislauf: „Modellhaft<br />
ausgedrückt stehen sich in einer modernen Wirtschaft Haushalte und Unternehmen als<br />
Tauschpartner gegenüber. Sie tauschen Arbeitsleistungen gegen Löhne und Gehälter und dieses<br />
Haushaltseinkommen wiederum gegen Wirtschaftsgüter. Laufend bewegen sich Geld und<br />
Güterströme zwischen ihnen hin und her“ (S. 88). Diese Art der Darstellung weist Unternehmen<br />
ausschließlich eine statische Funktion zu – ohne beispielsweise auch nur ansatzweise Chancen<br />
und Risiken unternehmerischen Handelns anzusprechen. Sehr differenziert beschreiben die Autoren<br />
dagegen die Situation der Privathaushalte und die Bedeutung von Einkommen: „Wer Geld<br />
ausgeben möchte, muss zuallererst lernen, wie man Geld einnimmt“ (S. 78). Und: „Erwachsene<br />
________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Abschlussbericht</strong> vom 11. Januar 2010 Seite 67 von 114