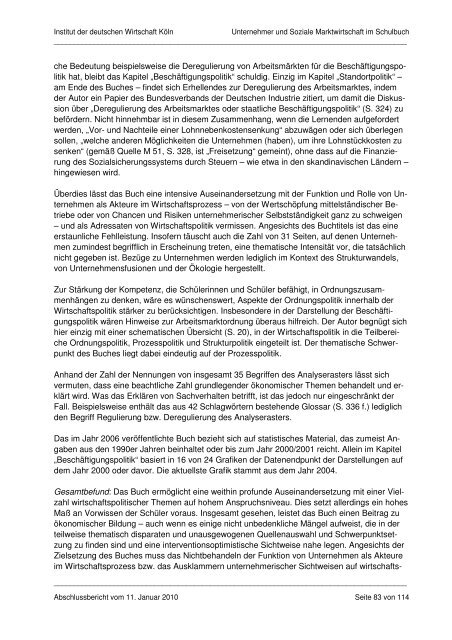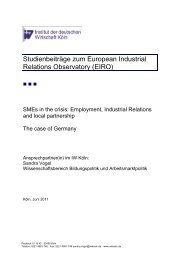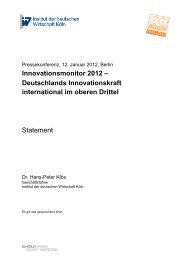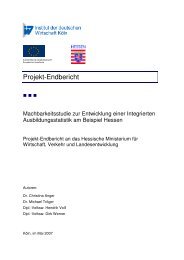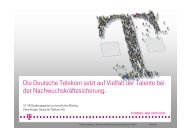Abschlussbericht - IW
Abschlussbericht - IW
Abschlussbericht - IW
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Institut der deutschen Wirtschaft Köln<br />
Unternehmer und Soziale Marktwirtschaft im Schulbuch<br />
________________________________________________________________________________________<br />
che Bedeutung beispielsweise die Deregulierung von Arbeitsmärkten für die Beschäftigungspolitik<br />
hat, bleibt das Kapitel „Beschäftigungspolitik“ schuldig. Einzig im Kapitel „Standortpolitik“ –<br />
am Ende des Buches – findet sich Erhellendes zur Deregulierung des Arbeitsmarktes, indem<br />
der Autor ein Papier des Bundesverbands der Deutschen Industrie zitiert, um damit die Diskussion<br />
über „Deregulierung des Arbeitsmarktes oder staatliche Beschäftigungspolitik“ (S. 324) zu<br />
befördern. Nicht hinnehmbar ist in diesem Zusammenhang, wenn die Lernenden aufgefordert<br />
werden, „Vor- und Nachteile einer Lohnnebenkostensenkung“ abzuwägen oder sich überlegen<br />
sollen, „welche anderen Möglichkeiten die Unternehmen (haben), um ihre Lohnstückkosten zu<br />
senken“ (gemäß Quelle M 51, S. 328, ist „Freisetzung“ gemeint), ohne dass auf die Finanzierung<br />
des Sozialsicherungssystems durch Steuern – wie etwa in den skandinavischen Ländern –<br />
hingewiesen wird.<br />
Überdies lässt das Buch eine intensive Auseinandersetzung mit der Funktion und Rolle von Unternehmen<br />
als Akteure im Wirtschaftsprozess – von der Wertschöpfung mittelständischer Betriebe<br />
oder von Chancen und Risiken unternehmerischer Selbstständigkeit ganz zu schweigen<br />
– und als Adressaten von Wirtschaftspolitik vermissen. Angesichts des Buchtitels ist das eine<br />
erstaunliche Fehlleistung. Insofern täuscht auch die Zahl von 31 Seiten, auf denen Unternehmen<br />
zumindest begrifflich in Erscheinung treten, eine thematische Intensität vor, die tatsächlich<br />
nicht gegeben ist. Bezüge zu Unternehmen werden lediglich im Kontext des Strukturwandels,<br />
von Unternehmensfusionen und der Ökologie hergestellt.<br />
Zur Stärkung der Kompetenz, die Schülerinnen und Schüler befähigt, in Ordnungszusammenhängen<br />
zu denken, wäre es wünschenswert, Aspekte der Ordnungspolitik innerhalb der<br />
Wirtschaftspolitik stärker zu berücksichtigen. Insbesondere in der Darstellung der Beschäftigungspolitik<br />
wären Hinweise zur Arbeitsmarktordnung überaus hilfreich. Der Autor begnügt sich<br />
hier einzig mit einer schematischen Übersicht (S. 20), in der Wirtschaftspolitik in die Teilbereiche<br />
Ordnungspolitik, Prozesspolitik und Strukturpolitik eingeteilt ist. Der thematische Schwerpunkt<br />
des Buches liegt dabei eindeutig auf der Prozesspolitik.<br />
Anhand der Zahl der Nennungen von insgesamt 35 Begriffen des Analyserasters lässt sich<br />
vermuten, dass eine beachtliche Zahl grundlegender ökonomischer Themen behandelt und erklärt<br />
wird. Was das Erklären von Sachverhalten betrifft, ist das jedoch nur eingeschränkt der<br />
Fall. Beispielsweise enthält das aus 42 Schlagwörtern bestehende Glossar (S. 336 f.) lediglich<br />
den Begriff Regulierung bzw. Deregulierung des Analyserasters.<br />
Das im Jahr 2006 veröffentlichte Buch bezieht sich auf statistisches Material, das zumeist Angaben<br />
aus den 1990er Jahren beinhaltet oder bis zum Jahr 2000/2001 reicht. Allein im Kapitel<br />
„Beschäftigungspolitik“ basiert in 16 von 24 Grafiken der Datenendpunkt der Darstellungen auf<br />
dem Jahr 2000 oder davor. Die aktuellste Grafik stammt aus dem Jahr 2004.<br />
Gesamtbefund: Das Buch ermöglicht eine weithin profunde Auseinandersetzung mit einer Vielzahl<br />
wirtschaftspolitischer Themen auf hohem Anspruchsniveau. Dies setzt allerdings ein hohes<br />
Maß an Vorwissen der Schüler voraus. Insgesamt gesehen, leistet das Buch einen Beitrag zu<br />
ökonomischer Bildung – auch wenn es einige nicht unbedenkliche Mängel aufweist, die in der<br />
teilweise thematisch disparaten und unausgewogenen Quellenauswahl und Schwerpunktsetzung<br />
zu finden sind und eine interventionsoptimistische Sichtweise nahe legen. Angesichts der<br />
Zielsetzung des Buches muss das Nichtbehandeln der Funktion von Unternehmen als Akteure<br />
im Wirtschaftsprozess bzw. das Ausklammern unternehmerischer Sichtweisen auf wirtschafts-<br />
________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Abschlussbericht</strong> vom 11. Januar 2010 Seite 83 von 114