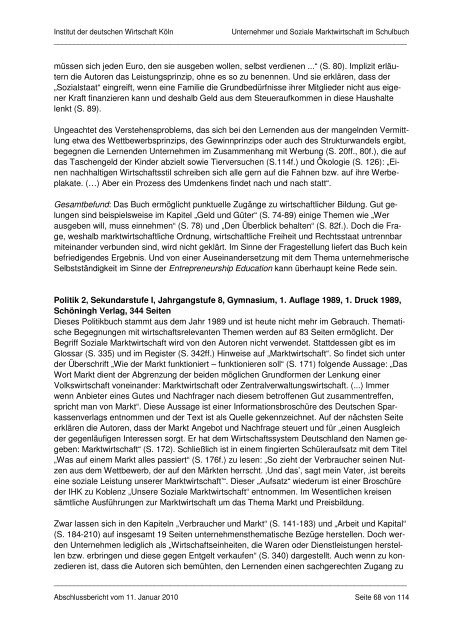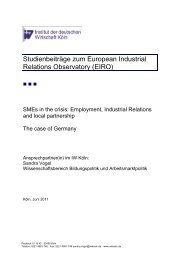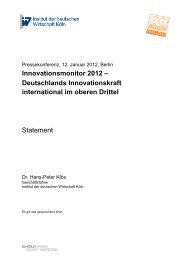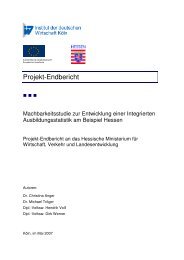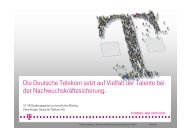Abschlussbericht - IW
Abschlussbericht - IW
Abschlussbericht - IW
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Institut der deutschen Wirtschaft Köln<br />
Unternehmer und Soziale Marktwirtschaft im Schulbuch<br />
________________________________________________________________________________________<br />
müssen sich jeden Euro, den sie ausgeben wollen, selbst verdienen ...“ (S. 80). Implizit erläutern<br />
die Autoren das Leistungsprinzip, ohne es so zu benennen. Und sie erklären, dass der<br />
„Sozialstaat“ eingreift, wenn eine Familie die Grundbedürfnisse ihrer Mitglieder nicht aus eigener<br />
Kraft finanzieren kann und deshalb Geld aus dem Steueraufkommen in diese Haushalte<br />
lenkt (S. 89).<br />
Ungeachtet des Verstehensproblems, das sich bei den Lernenden aus der mangelnden Vermittlung<br />
etwa des Wettbewerbsprinzips, des Gewinnprinzips oder auch des Strukturwandels ergibt,<br />
begegnen die Lernenden Unternehmen im Zusammenhang mit Werbung (S. 20ff., 80f.), die auf<br />
das Taschengeld der Kinder abzielt sowie Tierversuchen (S.114f.) und Ökologie (S. 126): „Einen<br />
nachhaltigen Wirtschaftsstil schreiben sich alle gern auf die Fahnen bzw. auf ihre Werbeplakate.<br />
(…) Aber ein Prozess des Umdenkens findet nach und nach statt“.<br />
Gesamtbefund: Das Buch ermöglicht punktuelle Zugänge zu wirtschaftlicher Bildung. Gut gelungen<br />
sind beispielsweise im Kapitel „Geld und Güter“ (S. 74-89) einige Themen wie „Wer<br />
ausgeben will, muss einnehmen“ (S. 78) und „Den Überblick behalten“ (S. 82f.). Doch die Frage,<br />
weshalb marktwirtschaftliche Ordnung, wirtschaftliche Freiheit und Rechtsstaat untrennbar<br />
miteinander verbunden sind, wird nicht geklärt. Im Sinne der Fragestellung liefert das Buch kein<br />
befriedigendes Ergebnis. Und von einer Auseinandersetzung mit dem Thema unternehmerische<br />
Selbstständigkeit im Sinne der Entrepreneurship Education kann überhaupt keine Rede sein.<br />
Politik 2, Sekundarstufe I, Jahrgangstufe 8, Gymnasium, 1. Auflage 1989, 1. Druck 1989,<br />
Schöningh Verlag, 344 Seiten<br />
Dieses Politikbuch stammt aus dem Jahr 1989 und ist heute nicht mehr im Gebrauch. Thematische<br />
Begegnungen mit wirtschaftsrelevanten Themen werden auf 83 Seiten ermöglicht. Der<br />
Begriff Soziale Marktwirtschaft wird von den Autoren nicht verwendet. Stattdessen gibt es im<br />
Glossar (S. 335) und im Register (S. 342ff.) Hinweise auf „Marktwirtschaft“. So findet sich unter<br />
der Überschrift „Wie der Markt funktioniert – funktionieren soll“ (S. 171) folgende Aussage: „Das<br />
Wort Markt dient der Abgrenzung der beiden möglichen Grundformen der Lenkung einer<br />
Volkswirtschaft voneinander: Marktwirtschaft oder Zentralverwaltungswirtschaft. (...) Immer<br />
wenn Anbieter eines Gutes und Nachfrager nach diesem betroffenen Gut zusammentreffen,<br />
spricht man von Markt“. Diese Aussage ist einer Informationsbroschüre des Deutschen Sparkassenverlags<br />
entnommen und der Text ist als Quelle gekennzeichnet. Auf der nächsten Seite<br />
erklären die Autoren, dass der Markt Angebot und Nachfrage steuert und für „einen Ausgleich<br />
der gegenläufigen Interessen sorgt. Er hat dem Wirtschaftssystem Deutschland den Namen gegeben:<br />
Marktwirtschaft“ (S. 172). Schließlich ist in einem fingierten Schüleraufsatz mit dem Titel<br />
„Was auf einem Markt alles passiert“ (S. 176f.) zu lesen: „So zieht der Verbraucher seinen Nutzen<br />
aus dem Wettbewerb, der auf den Märkten herrscht. ‚Und das’, sagt mein Vater, ‚ist bereits<br />
eine soziale Leistung unserer Marktwirtschaft’“. Dieser „Aufsatz“ wiederum ist einer Broschüre<br />
der IHK zu Koblenz „Unsere Soziale Marktwirtschaft“ entnommen. Im Wesentlichen kreisen<br />
sämtliche Ausführungen zur Marktwirtschaft um das Thema Markt und Preisbildung.<br />
Zwar lassen sich in den Kapiteln „Verbraucher und Markt“ (S. 141-183) und „Arbeit und Kapital“<br />
(S. 184-210) auf insgesamt 19 Seiten unternehmensthematische Bezüge herstellen. Doch werden<br />
Unternehmen lediglich als „Wirtschaftseinheiten, die Waren oder Dienstleistungen herstellen<br />
bzw. erbringen und diese gegen Entgelt verkaufen“ (S. 340) dargestellt. Auch wenn zu konzedieren<br />
ist, dass die Autoren sich bemühten, den Lernenden einen sachgerechten Zugang zu<br />
________________________________________________________________________________________<br />
<strong>Abschlussbericht</strong> vom 11. Januar 2010 Seite 68 von 114