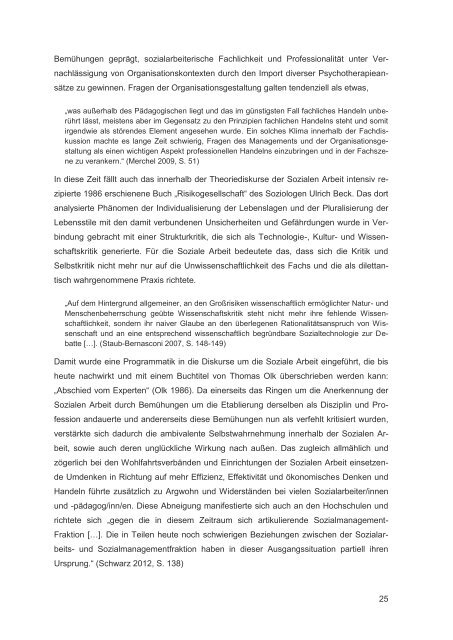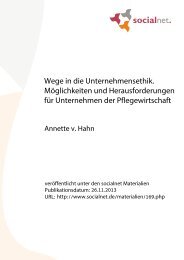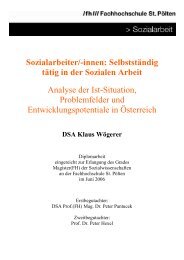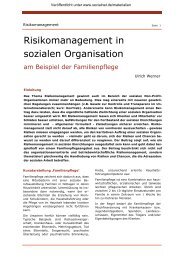Masterarbeit als PDF/A-Datei (6,7 MB) - Socialnet
Masterarbeit als PDF/A-Datei (6,7 MB) - Socialnet
Masterarbeit als PDF/A-Datei (6,7 MB) - Socialnet
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Bemühungen geprägt, sozialarbeiterische Fachlichkeit und Professionalität unter Vernachlässigung<br />
von Organisationskontexten durch den Import diverser Psychotherapieansätze<br />
zu gewinnen. Fragen der Organisationsgestaltung galten tendenziell <strong>als</strong> etwas,<br />
„was außerhalb des Pädagogischen liegt und das im günstigsten Fall fachliches Handeln unberührt<br />
lässt, meistens aber im Gegensatz zu den Prinzipien fachlichen Handelns steht und somit<br />
irgendwie <strong>als</strong> störendes Element angesehen wurde. Ein solches Klima innerhalb der Fachdiskussion<br />
machte es lange Zeit schwierig, Fragen des Managements und der Organisationsgestaltung<br />
<strong>als</strong> einen wichtigen Aspekt professionellen Handelns einzubringen und in der Fachszene<br />
zu verankern.“ (Merchel 2009, S. 51)<br />
In diese Zeit fällt auch das innerhalb der Theoriediskurse der Sozialen Arbeit intensiv rezipierte<br />
1986 erschienene Buch „Risikogesellschaft“ des Soziologen Ulrich Beck. Das dort<br />
analysierte Phänomen der Individualisierung der Lebenslagen und der Pluralisierung der<br />
Lebensstile mit den damit verbundenen Unsicherheiten und Gefährdungen wurde in Verbindung<br />
gebracht mit einer Strukturkritik, die sich <strong>als</strong> Technologie-, Kultur- und Wissenschaftskritik<br />
generierte. Für die Soziale Arbeit bedeutete das, dass sich die Kritik und<br />
Selbstkritik nicht mehr nur auf die Unwissenschaftlichkeit des Fachs und die <strong>als</strong> dilettantisch<br />
wahrgenommene Praxis richtete.<br />
„Auf dem Hintergrund allgemeiner, an den Großrisiken wissenschaftlich ermöglichter Natur- und<br />
Menschenbeherrschung geübte Wissenschaftskritik steht nicht mehr ihre fehlende Wissenschaftlichkeit,<br />
sondern ihr naiver Glaube an den überlegenen Rationalitätsanspruch von Wissenschaft<br />
und an eine entsprechend wissenschaftlich begründbare Sozialtechnologie zur Debatte<br />
[…]. (Staub-Bernasconi 2007, S. 148-149)<br />
Damit wurde eine Programmatik in die Diskurse um die Soziale Arbeit eingeführt, die bis<br />
heute nachwirkt und mit einem Buchtitel von Thomas Olk überschrieben werden kann:<br />
„Abschied vom Experten“ (Olk 1986). Da einerseits das Ringen um die Anerkennung der<br />
Sozialen Arbeit durch Bemühungen um die Etablierung derselben <strong>als</strong> Disziplin und Profession<br />
andauerte und andererseits diese Bemühungen nun <strong>als</strong> verfehlt kritisiert wurden,<br />
verstärkte sich dadurch die ambivalente Selbstwahrnehmung innerhalb der Sozialen Arbeit,<br />
sowie auch deren unglückliche Wirkung nach außen. Das zugleich allmählich und<br />
zögerlich bei den Wohlfahrtsverbänden und Einrichtungen der Sozialen Arbeit einsetzende<br />
Umdenken in Richtung auf mehr Effizienz, Effektivität und ökonomisches Denken und<br />
Handeln führte zusätzlich zu Argwohn und Widerständen bei vielen Sozialarbeiter/innen<br />
und -pädagog/inn/en. Diese Abneigung manifestierte sich auch an den Hochschulen und<br />
richtete sich „gegen die in diesem Zeitraum sich artikulierende Sozialmanagement-<br />
Fraktion […]. Die in Teilen heute noch schwierigen Beziehungen zwischen der Sozialarbeits-<br />
und Sozialmanagementfraktion haben in dieser Ausgangssituation partiell ihren<br />
Ursprung.“ (Schwarz 2012, S. 138)<br />
25