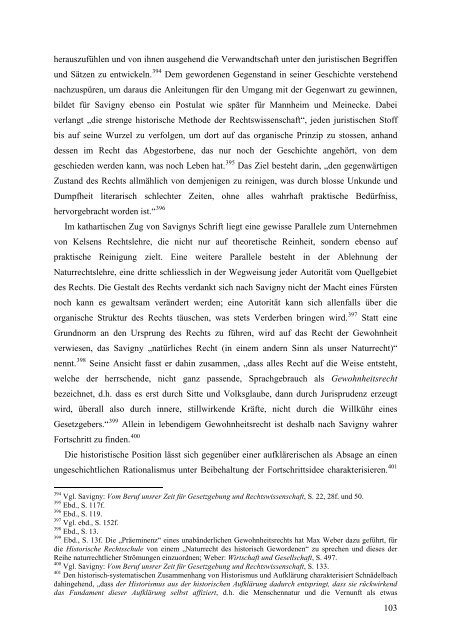Gesetz ohne Gott
Gesetz ohne Gott
Gesetz ohne Gott
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
herauszufühlen und von ihnen ausgehend die Verwandtschaft unter den juristischen Begriffen<br />
und Sätzen zu entwickeln. 394 Dem gewordenen Gegenstand in seiner Geschichte verstehend<br />
nachzuspüren, um daraus die Anleitungen für den Umgang mit der Gegenwart zu gewinnen,<br />
bildet für Savigny ebenso ein Postulat wie später für Mannheim und Meinecke. Dabei<br />
verlangt „die strenge historische Methode der Rechtswissenschaft“, jeden juristischen Stoff<br />
bis auf seine Wurzel zu verfolgen, um dort auf das organische Prinzip zu stossen, anhand<br />
dessen im Recht das Abgestorbene, das nur noch der Geschichte angehört, von dem<br />
geschieden werden kann, was noch Leben hat. 395 Das Ziel besteht darin, „den gegenwärtigen<br />
Zustand des Rechts allmählich von demjenigen zu reinigen, was durch blosse Unkunde und<br />
Dumpfheit literarisch schlechter Zeiten, <strong>ohne</strong> alles wahrhaft praktische Bedürfniss,<br />
hervorgebracht worden ist.“ 396<br />
Im kathartischen Zug von Savignys Schrift liegt eine gewisse Parallele zum Unternehmen<br />
von Kelsens Rechtslehre, die nicht nur auf theoretische Reinheit, sondern ebenso auf<br />
praktische Reinigung zielt. Eine weitere Parallele besteht in der Ablehnung der<br />
Naturrechtslehre, eine dritte schliesslich in der Wegweisung jeder Autorität vom Quellgebiet<br />
des Rechts. Die Gestalt des Rechts verdankt sich nach Savigny nicht der Macht eines Fürsten<br />
noch kann es gewaltsam verändert werden; eine Autorität kann sich allenfalls über die<br />
397<br />
organische Struktur des Rechts täuschen, was stets Verderben bringen wird. Statt eine<br />
Grundnorm an den Ursprung des Rechts zu führen, wird auf das Recht der Gewohnheit<br />
verwiesen, das Savigny „natürliches Recht (in einem andern Sinn als unser Naturrecht)“<br />
nennt. 398 Seine Ansicht fasst er dahin zusammen, „dass alles Recht auf die Weise entsteht,<br />
welche der herrschende, nicht ganz passende, Sprachgebrauch als Gewohnheitsrecht<br />
bezeichnet, d.h. dass es erst durch Sitte und Volksglaube, dann durch Jurisprudenz erzeugt<br />
wird, überall also durch innere, stillwirkende Kräfte, nicht durch die Willkühr eines<br />
<strong>Gesetz</strong>gebers.“ 399 Allein in lebendigem Gewohnheitsrecht ist deshalb nach Savigny wahrer<br />
Fortschritt zu finden. 400<br />
Die historistische Position lässt sich gegenüber einer aufklärerischen als Absage an einen<br />
401<br />
ungeschichtlichen Rationalismus unter Beibehaltung der Fortschrittsidee charakterisieren.<br />
394<br />
Vgl. Savigny: Vom Beruf unsrer Zeit für <strong>Gesetz</strong>gebung und Rechtswissenschaft, S. 22, 28f. und 50.<br />
395<br />
Ebd., S. 117f.<br />
396<br />
Ebd., S. 119.<br />
397<br />
Vgl. ebd., S. 152f.<br />
398<br />
Ebd., S. 13.<br />
399<br />
Ebd., S. 13f. Die „Präeminenz“ eines unabänderlichen Gewohnheitsrechts hat Max Weber dazu geführt, für<br />
die Historische Rechtsschule von einem „Naturrecht des historisch Gewordenen“ zu sprechen und dieses der<br />
Reihe naturrechtlicher Strömungen einzuordnen; Weber: Wirtschaft und Gesellschaft, S. 497.<br />
400<br />
Vgl. Savigny: Vom Beruf unsrer Zeit für <strong>Gesetz</strong>gebung und Rechtswissenschaft, S. 133.<br />
401<br />
Den historisch-systematischen Zusammenhang von Historismus und Aufklärung charakterisiert Schnädelbach<br />
dahingehend, „dass der Historismus aus der historischen Aufklärung dadurch entspringt, dass sie rückwirkend<br />
das Fundament dieser Aufklärung selbst affiziert, d.h. die Menschennatur und die Vernunft als etwas<br />
103