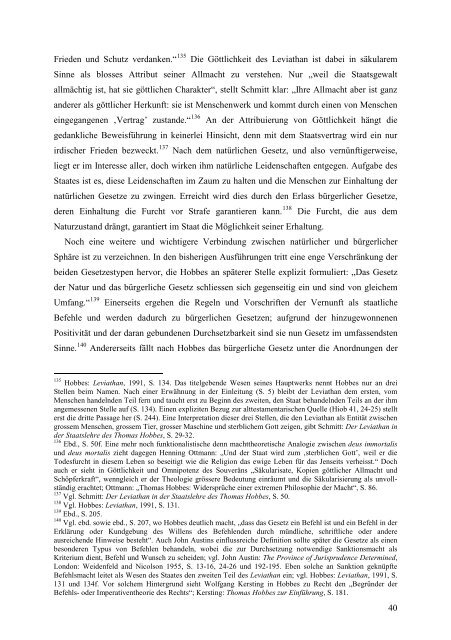Gesetz ohne Gott
Gesetz ohne Gott
Gesetz ohne Gott
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Frieden und Schutz verdanken.“ 135 Die Göttlichkeit des Leviathan ist dabei in säkularem<br />
Sinne als blosses Attribut seiner Allmacht zu verstehen. Nur „weil die Staatsgewalt<br />
allmächtig ist, hat sie göttlichen Charakter“, stellt Schmitt klar: „Ihre Allmacht aber ist ganz<br />
anderer als göttlicher Herkunft: sie ist Menschenwerk und kommt durch einen von Menschen<br />
eingegangenen ‚Vertrag’ zustande.“ 136 An der Attribuierung von Göttlichkeit hängt die<br />
gedankliche Beweisführung in keinerlei Hinsicht, denn mit dem Staatsvertrag wird ein nur<br />
irdischer Frieden bezweckt. 137 Nach dem natürlichen <strong>Gesetz</strong>, und also vernünftigerweise,<br />
liegt er im Interesse aller, doch wirken ihm natürliche Leidenschaften entgegen. Aufgabe des<br />
Staates ist es, diese Leidenschaften im Zaum zu halten und die Menschen zur Einhaltung der<br />
natürlichen <strong>Gesetz</strong>e zu zwingen. Erreicht wird dies durch den Erlass bürgerlicher <strong>Gesetz</strong>e,<br />
deren Einhaltung die Furcht vor Strafe garantieren kann. 138<br />
Die Furcht, die aus dem<br />
Naturzustand drängt, garantiert im Staat die Möglichkeit seiner Erhaltung.<br />
Noch eine weitere und wichtigere Verbindung zwischen natürlicher und bürgerlicher<br />
Sphäre ist zu verzeichnen. In den bisherigen Ausführungen tritt eine enge Verschränkung der<br />
beiden <strong>Gesetz</strong>estypen hervor, die Hobbes an späterer Stelle explizit formuliert: „Das <strong>Gesetz</strong><br />
der Natur und das bürgerliche <strong>Gesetz</strong> schliessen sich gegenseitig ein und sind von gleichem<br />
139<br />
Umfang.“ Einerseits ergehen die Regeln und Vorschriften der Vernunft als staatliche<br />
Befehle und werden dadurch zu bürgerlichen <strong>Gesetz</strong>en; aufgrund der hinzugewonnenen<br />
Positivität und der daran gebundenen Durchsetzbarkeit sind sie nun <strong>Gesetz</strong> im umfassendsten<br />
Sinne. 140<br />
Andererseits fällt nach Hobbes das bürgerliche <strong>Gesetz</strong> unter die Anordnungen der<br />
135 Hobbes: Leviathan, 1991, S. 134. Das titelgebende Wesen seines Hauptwerks nennt Hobbes nur an drei<br />
Stellen beim Namen. Nach einer Erwähnung in der Einleitung (S. 5) bleibt der Leviathan dem ersten, vom<br />
Menschen handelnden Teil fern und taucht erst zu Beginn des zweiten, den Staat behandelnden Teils an der ihm<br />
angemessenen Stelle auf (S. 134). Einen expliziten Bezug zur alttestamentarischen Quelle (Hiob 41, 24-25) stellt<br />
erst die dritte Passage her (S. 244). Eine Interpretation dieser drei Stellen, die den Leviathan als Entität zwischen<br />
grossem Menschen, grossem Tier, grosser Maschine und sterblichem <strong>Gott</strong> zeigen, gibt Schmitt: Der Leviathan in<br />
der Staatslehre des Thomas Hobbes, S. 29-32.<br />
136 Ebd., S. 50f. Eine mehr noch funktionalistische denn machttheoretische Analogie zwischen deus immortalis<br />
und deus mortalis zieht dagegen Henning Ottmann: „Und der Staat wird zum ‚sterblichen <strong>Gott</strong>’, weil er die<br />
Todesfurcht in diesem Leben so beseitigt wie die Religion das ewige Leben für das Jenseits verheisst.“ Doch<br />
auch er sieht in Göttlichkeit und Omnipotenz des Souveräns „Säkularisate, Kopien göttlicher Allmacht und<br />
Schöpferkraft“, wenngleich er der Theologie grössere Bedeutung einräumt und die Säkularisierung als unvollständig<br />
erachtet; Ottmann: „Thomas Hobbes: Widersprüche einer extremen Philosophie der Macht“, S. 86.<br />
137 Vgl. Schmitt: Der Leviathan in der Staatslehre des Thomas Hobbes, S. 50.<br />
138 Vgl. Hobbes: Leviathan, 1991, S. 131.<br />
139 Ebd., S. 205.<br />
140 Vgl. ebd. sowie ebd., S. 207, wo Hobbes deutlich macht, „dass das <strong>Gesetz</strong> ein Befehl ist und ein Befehl in der<br />
Erklärung oder Kundgebung des Willens des Befehlenden durch mündliche, schriftliche oder andere<br />
ausreichende Hinweise besteht“. Auch John Austins einflussreiche Definition sollte später die <strong>Gesetz</strong>e als einen<br />
besonderen Typus von Befehlen behandeln, wobei die zur Durchsetzung notwendige Sanktionsmacht als<br />
Kriterium dient, Befehl und Wunsch zu scheiden; vgl. John Austin: The Province of Jurisprudence Determined,<br />
London: Weidenfeld and Nicolson 1955, S. 13-16, 24-26 und 192-195. Eben solche an Sanktion geknüpfte<br />
Befehlsmacht leitet als Wesen des Staates den zweiten Teil des Leviathan ein; vgl. Hobbes: Leviathan, 1991, S.<br />
131 und 134f. Vor solchem Hintergrund sieht Wolfgang Kersting in Hobbes zu Recht den „Begründer der<br />
Befehls- oder Imperativentheorie des Rechts“; Kersting: Thomas Hobbes zur Einführung, S. 181.<br />
40