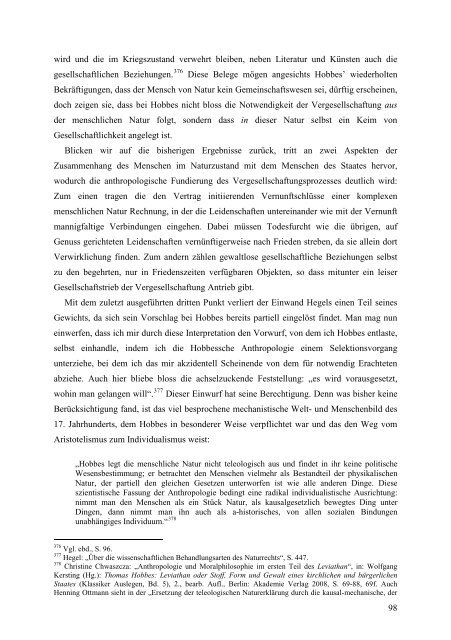Gesetz ohne Gott
Gesetz ohne Gott
Gesetz ohne Gott
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
wird und die im Kriegszustand verwehrt bleiben, neben Literatur und Künsten auch die<br />
gesellschaftlichen Beziehungen. 376<br />
Diese Belege mögen angesichts Hobbes’ wiederholten<br />
Bekräftigungen, dass der Mensch von Natur kein Gemeinschaftswesen sei, dürftig erscheinen,<br />
doch zeigen sie, dass bei Hobbes nicht bloss die Notwendigkeit der Vergesellschaftung aus<br />
der menschlichen Natur folgt, sondern dass in dieser Natur selbst ein Keim von<br />
Gesellschaftlichkeit angelegt ist.<br />
Blicken wir auf die bisherigen Ergebnisse zurück, tritt an zwei Aspekten der<br />
Zusammenhang des Menschen im Naturzustand mit dem Menschen des Staates hervor,<br />
wodurch die anthropologische Fundierung des Vergesellschaftungsprozesses deutlich wird:<br />
Zum einen tragen die den Vertrag initiierenden Vernunftschlüsse einer komplexen<br />
menschlichen Natur Rechnung, in der die Leidenschaften untereinander wie mit der Vernunft<br />
mannigfaltige Verbindungen eingehen. Dabei müssen Todesfurcht wie die übrigen, auf<br />
Genuss gerichteten Leidenschaften vernünftigerweise nach Frieden streben, da sie allein dort<br />
Verwirklichung finden. Zum andern zählen gewaltlose gesellschaftliche Beziehungen selbst<br />
zu den begehrten, nur in Friedenszeiten verfügbaren Objekten, so dass mitunter ein leiser<br />
Gesellschaftstrieb der Vergesellschaftung Antrieb gibt.<br />
Mit dem zuletzt ausgeführten dritten Punkt verliert der Einwand Hegels einen Teil seines<br />
Gewichts, da sich sein Vorschlag bei Hobbes bereits partiell eingelöst findet. Man mag nun<br />
einwerfen, dass ich mir durch diese Interpretation den Vorwurf, von dem ich Hobbes entlaste,<br />
selbst einhandle, indem ich die Hobbessche Anthropologie einem Selektionsvorgang<br />
unterziehe, bei dem ich das mir akzidentell Scheinende von dem für notwendig Erachteten<br />
abziehe. Auch hier bliebe bloss die achselzuckende Feststellung: „es wird vorausgesetzt,<br />
wohin man gelangen will“. 377<br />
Dieser Einwurf hat seine Berechtigung. Denn was bisher keine<br />
Berücksichtigung fand, ist das viel besprochene mechanistische Welt- und Menschenbild des<br />
17. Jahrhunderts, dem Hobbes in besonderer Weise verpflichtet war und das den Weg vom<br />
Aristotelismus zum Individualismus weist:<br />
„Hobbes legt die menschliche Natur nicht teleologisch aus und findet in ihr keine politische<br />
Wesensbestimmung; er betrachtet den Menschen vielmehr als Bestandteil der physikalischen<br />
Natur, der partiell den gleichen <strong>Gesetz</strong>en unterworfen ist wie alle anderen Dinge. Diese<br />
szientistische Fassung der Anthropologie bedingt eine radikal individualistische Ausrichtung:<br />
nimmt man den Menschen als ein Stück Natur, als kausalgesetzlich bewegtes Ding unter<br />
Dingen, dann nimmt man ihn auch als a-historisches, von allen sozialen Bindungen<br />
unabhängiges Individuum.“ 378<br />
376 Vgl. ebd., S. 96.<br />
377 Hegel: „Über die wissenschaftlichen Behandlungsarten des Naturrechts“, S. 447.<br />
378 Christine Chwaszcza: „Anthropologie und Moralphilosophie im ersten Teil des Leviathan“, in: Wolfgang<br />
Kersting (Hg.): Thomas Hobbes: Leviathan oder Stoff, Form und Gewalt eines kirchlichen und bürgerlichen<br />
Staates (Klassiker Auslegen, Bd. 5), 2., bearb. Aufl., Berlin: Akademie Verlag 2008, S. 69-88, 69f. Auch<br />
Henning Ottmann sieht in der „Ersetzung der teleologischen Naturerklärung durch die kausal-mechanische, der<br />
98