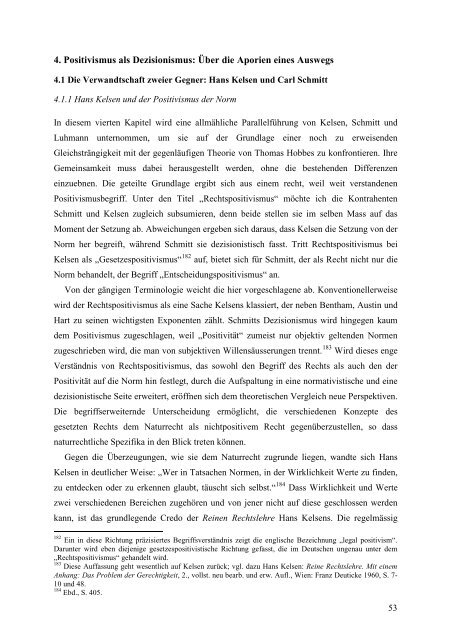Gesetz ohne Gott
Gesetz ohne Gott
Gesetz ohne Gott
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
4. Positivismus als Dezisionismus: Über die Aporien eines Auswegs<br />
4.1 Die Verwandtschaft zweier Gegner: Hans Kelsen und Carl Schmitt<br />
4.1.1 Hans Kelsen und der Positivismus der Norm<br />
In diesem vierten Kapitel wird eine allmähliche Parallelführung von Kelsen, Schmitt und<br />
Luhmann unternommen, um sie auf der Grundlage einer noch zu erweisenden<br />
Gleichsträngigkeit mit der gegenläufigen Theorie von Thomas Hobbes zu konfrontieren. Ihre<br />
Gemeinsamkeit muss dabei herausgestellt werden, <strong>ohne</strong> die bestehenden Differenzen<br />
einzuebnen. Die geteilte Grundlage ergibt sich aus einem recht, weil weit verstandenen<br />
Positivismusbegriff. Unter den Titel „Rechtspositivismus“ möchte ich die Kontrahenten<br />
Schmitt und Kelsen zugleich subsumieren, denn beide stellen sie im selben Mass auf das<br />
Moment der Setzung ab. Abweichungen ergeben sich daraus, dass Kelsen die Setzung von der<br />
Norm her begreift, während Schmitt sie dezisionistisch fasst. Tritt Rechtspositivismus bei<br />
Kelsen als „<strong>Gesetz</strong>espositivismus“ 182<br />
auf, bietet sich für Schmitt, der als Recht nicht nur die<br />
Norm behandelt, der Begriff „Entscheidungspositivismus“ an.<br />
Von der gängigen Terminologie weicht die hier vorgeschlagene ab. Konventionellerweise<br />
wird der Rechtspositivismus als eine Sache Kelsens klassiert, der neben Bentham, Austin und<br />
Hart zu seinen wichtigsten Exponenten zählt. Schmitts Dezisionismus wird hingegen kaum<br />
dem Positivismus zugeschlagen, weil „Positivität“ zumeist nur objektiv geltenden Normen<br />
183<br />
zugeschrieben wird, die man von subjektiven Willensäusserungen trennt. Wird dieses enge<br />
Verständnis von Rechtspositivismus, das sowohl den Begriff des Rechts als auch den der<br />
Positivität auf die Norm hin festlegt, durch die Aufspaltung in eine normativistische und eine<br />
dezisionistische Seite erweitert, eröffnen sich dem theoretischen Vergleich neue Perspektiven.<br />
Die begriffserweiternde Unterscheidung ermöglicht, die verschiedenen Konzepte des<br />
gesetzten Rechts dem Naturrecht als nichtpositivem Recht gegenüberzustellen, so dass<br />
naturrechtliche Spezifika in den Blick treten können.<br />
Gegen die Überzeugungen, wie sie dem Naturrecht zugrunde liegen, wandte sich Hans<br />
Kelsen in deutlicher Weise: „Wer in Tatsachen Normen, in der Wirklichkeit Werte zu finden,<br />
184<br />
zu entdecken oder zu erkennen glaubt, täuscht sich selbst.“ Dass Wirklichkeit und Werte<br />
zwei verschiedenen Bereichen zugehören und von jener nicht auf diese geschlossen werden<br />
kann, ist das grundlegende Credo der Reinen Rechtslehre Hans Kelsens. Die regelmässig<br />
182 Ein in diese Richtung präzisiertes Begriffsverständnis zeigt die englische Bezeichnung „legal positivism“.<br />
Darunter wird eben diejenige gesetzespositivistische Richtung gefasst, die im Deutschen ungenau unter dem<br />
„Rechtspositivismus“ gehandelt wird.<br />
183 Diese Auffassung geht wesentlich auf Kelsen zurück; vgl. dazu Hans Kelsen: Reine Rechtslehre. Mit einem<br />
Anhang: Das Problem der Gerechtigkeit, 2., vollst. neu bearb. und erw. Aufl., Wien: Franz Deuticke 1960, S. 7-<br />
10 und 48.<br />
184 Ebd., S. 405.<br />
53