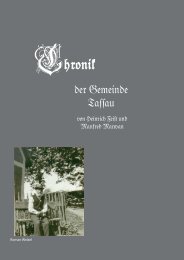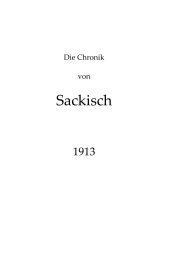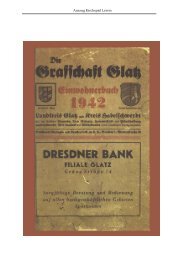hier rechte Maustaste... - Lewin
hier rechte Maustaste... - Lewin
hier rechte Maustaste... - Lewin
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
der Zeit des Holzschlages ihre Arbeitskraft, jedoch gegen Entschädigung, zur Verfügung zu<br />
stellen. Die Naturallieferung von Fichtenzapfen wurde später in einen Fichtenzapfen-Zins<br />
umgewandelt. Inbezug auf den Mühlzwang behielten nach den Bestimmungen des alten<br />
Urbariums die Unterthanen die früheren Freiheiten. Im Dörfchen befand sich noch keine<br />
Mühle, jedoch hatte für die Anlage einer solchen das Königliche Rentamt schon lange insofern<br />
Vorsorge getroffen, daß der Besitzer der Stelle No. 4 verpflichtet war, den dazu erforderlichen<br />
Grund und Boden von seiner Possession herzugeben, wofür er durch ein anderes Stück Land<br />
entschädigt werden sollte.<br />
Den Bierbedarf mußten die Dörnikauer aus <strong>Lewin</strong> oder Reinerz entnehmen, „wo sie solches<br />
am besten haben konnten". Den Brantwein lieferte der Besitzer der Stelle No. 13, Joseph<br />
Erbe, welcher 1786 die Gerechtigkeit des Branntweinbrennens für den Preis von 130 Thaler<br />
käuflich erworben hatte. Die Unterthanen waren angewiesen, von ihm das Getränk zu<br />
entnehmen. Später wurde noch eine zweite Brennerei im Dorfe errichtet.<br />
Mit dem Dienstzwange waren auch jetzt die Bewohner des Dorfes nicht belastet worden. Ihre<br />
Kinder durften sich vermiethen, wo sie wollten.<br />
Ebenso behielt auch die Gemeinde, wie früher, gegen Entrichtung von 1 Guld. 10 Kreuzer das<br />
Fischrecht im Dorfwasser. Die Benutzung desselben stand dem Schulzen zu.<br />
Für das nach dem alten Urbarium unserer Vorfahren zustehende Recht der Sichelgräserei u.<br />
Viehhutung in den königl. Forsten waren 1777 der Gemeinde 25 Waldschnüre (1 Waldschnur<br />
etwa 3 % Morgen) abgetreten worden. Für die Schnur mußten jährlich 5 Sgr., zusammen also<br />
4 Thl. 5 Sgr. an die Königl. Forstkasse antrichtet werden. Außerdem war vertragsmäßig<br />
festgesetzt worden: „Wenn auf denen 25 Waldschnüren Holz aufwachsen sollte, so gehört<br />
solches dem Dominio" (Forstfiskus). In die Benutzung der überwiesenen Fläche theilten sich<br />
die vorhandenen Stellen von No. 2 bis No. 13. Die Stelle No. 1 hatte, wie vordem an der<br />
Sichelgräserei u. Viehhutungsberechtigung, kein Anrecht.<br />
Die Gerichtsbarkeit über die Unterthanen des Dorfes übte das Königl. Rentamt in Glatz. Bei<br />
vorkommenden Verkäufen durften Laudemia, d.h. Lehngelder, nicht entrichtet, sondern nur<br />
die Sportein nach dem königl. Sportel Reglement vom Jahre 1740 erlegt werden. Für<br />
Loslassungs- u. Abzugsgelder war das königl. Edikt vom Jahre 1748 maßgebend.<br />
Der Gemeindevorstand bestand anfangs aus dem Richter und nur einem Geschworenen. Erst<br />
später wurden zwei Geschworene gewählt. Die Richter seit der Entstehung des Dorfes bis zur<br />
Ertheilung des neuen Urbariums im Jahre 1787 waren, soweit sich die Namen durch das<br />
Schöppenbuch feststellen lassen, folgende: Hans Tscheppen, Heinrich Stiller, der Ältere,<br />
Heinrich Stiller, der Jüngere, Franz Tschöpe, Joseph Wolff, George Martinetz, Johannes<br />
Schleicher und Anton Hasler.<br />
In kirchlicher Beziehung gehörte Dörnikau von Anfang an zum Pfarrsprengel von <strong>Lewin</strong>. Zur<br />
Entrichtung von Dezem oder sonstigen Accidenzien, wie sie die anderen zur Kirchgemeinde<br />
gehörenden Ortschaften leisten mußten, war das neue Dörfchen nicht angehalten worden. Nur<br />
6 Sgr. Neujahrsgeld wurden, seitdem der früher gebräuchliche Neujahrsumgang abgeschafft<br />
worden war, jährlich an die Küsterei von <strong>Lewin</strong> gezahlt.<br />
Für den Schulunterricht der heranwachsenden Dorfjugend war in den ersten hundert Jahren<br />
von keiner Seite Sorge getragen worden. Der abgelegene, unbedeutende Ort hat sich selbst<br />
unter der preußischen Herrschaft in dieser Beziehung noch längere Zeit der Aufmerksamkeit<br />
der Behörden entzogen. Den ersten Anfang mit dem Unterrichten der Kinder machte eine<br />
Schulmeisterin, eine von auswärts angezogene Witwe, die „Geiga-Liese" genannt, weil sie die<br />
Violine spielen konnte. Proben ihrer Schreibkunst sind noch heute vorhanden. Man soll jedoch<br />
ihre Fähigkeiten für Hexenkünste angesehen haben. Während man einerseits eine gewisse<br />
Scheu vor ihr hatte, war sie andererseits auch wieder der Gegenstand des Spottes. Sie verließ<br />
wohl deshalb den Ort wieder und zog nach Karlsberg. Nach ihrem Abzüge, zu Anfang dieses<br />
7