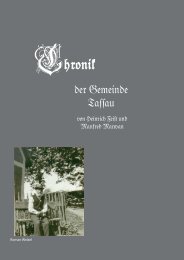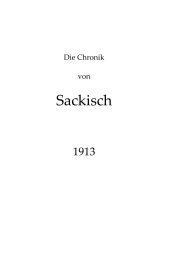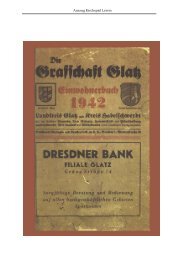hier rechte Maustaste... - Lewin
hier rechte Maustaste... - Lewin
hier rechte Maustaste... - Lewin
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Sachwerten, bzw. an Getreide. Infolge der nach der Inflation einsetzenden Kapitalknappheit<br />
und dem erfolgten Konkurs der Genossenschaft kam der Bau <strong>hier</strong>orts nicht zustande. Es<br />
schloß sich nur die Frau Gasthausbesitzer Römisch an das Tanzer Ortsnetz an.<br />
Die große Kapitalnot, bedingt durch das durch die Inflation verlorene Volksvermögen(,)<br />
verursachte den Zusammenbruch vieler Betriebe. Das Wirtschaftsleben lag schwer darnieder.<br />
Die Folge davon war eine große Arbeitslosigkeit. Um dem Elend der breiten Masse zu<br />
steuern, wurde Erwerbslosenunterstützung gezahlt. Diese betrug pro Mann 6,90 M., zuzüglich<br />
0,42 M Gemeindezuschlag 7.32 M. Auf die Frau kamen pro Tag 39 Pfg. und auf ein Kind pro<br />
Tag 27 Pfg. Erstere Unterstützungssumme wurde auf eine Woche gezahlt. Pro Tag ergibt das<br />
eine Unterstützung von 1,22 M.<br />
Im Oktober 1927 trat die Erwerbslosen Versicherung in Kraft. Die Unterstützungssätze<br />
staffelten sich nach dem Verdienst. Bei einem Wochenverdienst von 24 - 30 M. wurde z. B. an<br />
Unterstützung pro Woche 10.80 M gezahlt. Voraussetzung war, daß der Erwerbslose volle<br />
sechs Monate im Jahre in versicherungspflichtiger Arbeit gestanden hatte. Wer diese<br />
Bedingung nicht voll einhalten konnte, dem wurde Krisenunterstützung von einer Mark pro<br />
Tag gewährt. Erwerbslose waren verpflichtet auf Anordnung des Gemeindevorstehers<br />
sechzehn Stunden pro Woche vorkommende Gemeindearbeiten, wie Wegeausbesserung und<br />
dergl.(,) unentgeldlich auszuführen.<br />
Es wurden um die Arbeitsnot zu lindern Gelder von Reich, Staat, Kreis und Gemeinden<br />
ausgeworfen und zu Notstandsarbeiten verwandt. Mit dieser Maßnahme war der Grundstein<br />
zu hiesigem Straßenbau gelegt.<br />
Die Unpassirbarkeit des Dorfweges gab zu wiederholten Eingaben an das Kreisbauamt seitens<br />
des Gemeindevorstands um Wiederaufnahme des vor acht Jahren angefangenen und zum<br />
Stillstand gelangten Straßenneubaus Anlaß. Die regen Bemühungen waren endlich von Erfolg<br />
gekrönt.<br />
In der Kreistagsitzung vom 20. Dez. 1926 unter Vorsitz des Herrn Landrat Peuker wurde dem<br />
obigen langgehegten Wunsche der Gemeinde entsprochen und der Bau eines befestigten<br />
Landweges durch die Gemeinden Dörnikau und Kessel beschlossen. Die Baukosten wurden<br />
mit 150 000 GM. veranschlagt, wovon das Reich einen Teil deckte.<br />
Mit der Bauausführung betraut wurde das Tiefbauunternehmen Kuckerts - Köln,<br />
Zweigniederlassung Glatz. Leider ist zu bemerken, daß mit genannter Firma ein Fehlgriff getan<br />
war, da die technische Leitung auf dem Gebiet Straßenbau nicht voll auf der Höhe war.<br />
Begonnen wurde mit den Arbeiten am 6. Januar 1927 und zwar an der Grenzscheide<br />
Dörnikau-Kessel. Hier galt es, die Straße über die dort befindliche Schlucht zu leiten. Es war<br />
zunächst geplant, die zur Durchführung des Wassers nötige Kanalisation aus einem<br />
Sandsteingewölbe herzustellen. Statt nun die Vollendung dieses Baus abzuwarten, wurde ein<br />
Notkanal bestehend aus 214 Zoll starken Pfosten in Form eines Stollens von 30 m Länge, 4 m<br />
Breite und 3 m Höhe geschaffen, in dessen Hohlraum später der geplante Massivbau gesetzt<br />
werden sollte. Über den Holzkanal führte eine Brücke, belegt mit einem Schienenstrang. Von<br />
dieser aus rollten nun die Erdmassen auf den Holzbau, die Schlucht ausfüllend. Durch den<br />
Druck der Erdmassen wurden neue Versteifungen im Holzkanal nötig, die ihrerseits die lichte<br />
Weite desselben noch mehr verengten, so daß man von einem Sandsteinbau absehen mußte. Es<br />
tauchte nun der Gedanke auf, Cementrohre zu legen, wie dies in der Folge auch geschah. Ein<br />
Betonmeister, er später auch die Aufsicht über die Packungsarbeiten leitete, wurde mit dieser<br />
Arbeit betraut. Die Rohre wurden in eine Betonfüllung mit ca. 30 cm starker Decke gelegt.<br />
Hierauf strich man den Holzbau mit Teer, füllte den verbliebenen Hohlraum mit Reisig aus und<br />
setzte dieses in Brand um einer späteren Einbruchgefahr des Dammes vorzubeugen. Der<br />
Mehraufwand an Kosten betrug bei dieser Bauweise mehrere tausend Goldmark.<br />
31