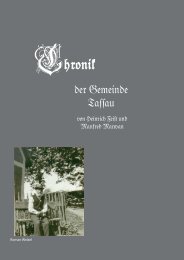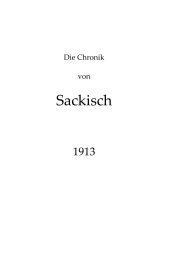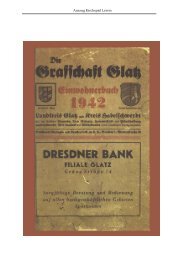hier rechte Maustaste... - Lewin
hier rechte Maustaste... - Lewin
hier rechte Maustaste... - Lewin
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
8<br />
Jahrhunderts, wurde das Dörfchen eine Filiale des Nothschullehrers von Hallatsch. Derselbe<br />
war ein Stellenbesitzer, Namens Feist. Er versah den Schuldienst in gemeinsinniger und<br />
entschieden ganz uneigennütziger Weise, was sich leicht aus der Besoldung schließen läßt. Er<br />
erhielt täglich 1 Vi Sgr. und an Emolumenten 6 einen Sack Korn. Zur Beheizung der Schulklasse<br />
wurden ihm zwei Klafter Holz geliefert. Das Schulamt wurde in der Feistschen Familie erblich.<br />
Der Sohn und Nachfolger des Alten war ein Kämpfer aus den Befreiungskriegen. Sein<br />
Tageslohn wurde auf 3 Sgr. erhöht. Im Winter kam er zur Abhaltung der Schulstunden gegen<br />
eine kleine Extra-Entschädigung dreimal nach Dörnikau; in den Sommermonaten mußten die<br />
hiesigen Kinder in den Schulort, nach Hallatsch, gehen. Feist, später nur der „alte Feist"<br />
genannt, war infolge seiner Beobachtungen ein Witterungsverständiger, der als Wetterprophet<br />
bei den Landleuten allgemeines Ansehen genoß. Nach seinem Tode wurde in gleicher Weise<br />
und mit derselben Uneigennützigkeit durch seinen älteren Sohn der Schuldienst weiter geführt,<br />
bis im Jahre 1874, nachdem in Hallatsch ein eigenes Schulhaus erbaut worden war, den alten<br />
Zuständen des Nothbehelfs durch Anstellung eines geprüften Lehrers ein Ende gemacht<br />
wurde. Derselbe hieß Josef Schruteck, starb aber schon nach lVijähriger Wirksamkeit. Sein<br />
Nachfolger ist der gegenwärtige Lehrer Theophil Pohl.<br />
Recht interessant ist, wie sich aus den vorhandenen Schriftstücken verschiedener Perioden auf<br />
den Schulbildungsstand der Ortsbewohner schließen läßt. Im Jahre 1683 waren der Richter<br />
Hans Tscheppen und sein Vater, der Forstknecht Hans Tscheppen, die einzigen<br />
Schreibkundigen. Sie waren jedenfalls angezogen und hatten anderswo entsprechende<br />
Schulbildung genossen. Ihre Namensunterschrift zeigt eine tüchtige Schreibfertigkeit.<br />
Uebrigens wurde auch der junge Tscheppen einige Jahre später Zolleinnehmer in Gießhübel. -<br />
Im Jahre 1787 findet sich unter den 14 Wirthen des Dörfchens nicht einer, der seinen Namen<br />
unterschreiben konnte, vielmehr mußte sich jeder zur Unterschrift des Urbariums des üblichen<br />
Handzeichens bedienen. Eine von 17 Stellenbesitzern aus dem Jahre 1851 unterzeichnete<br />
Urkunde weiset für den Zeitraum von 64 Jahren keinen besonderen Fortschritt auf. Nur sieben<br />
schreiben den Namen, die übrigen zehn unterkreuzten. Die Wirthe vor 30 Jahren gehörten<br />
sämtlich schon der Zeit an, in welcher der Schulunterricht für den Ort längst eingerichtet war,<br />
allein es war andererseits noch die Zeit, in der man denselben auch ungestraft vollkommen<br />
vernachläßigen durfte. - Auf einem Schriftstück vom Jahre 1874 finden sich unter 13<br />
Unterschriften nur noch zwei mit attestiertem Handzeichen.<br />
Die Errichtung des Dörfchens Dörnikau fällt in die Zeit, zu welcher in der Gegend die<br />
Leinenweberei recht in Aufschwung gekommen war. Neben der anfangs ebenso mühevollen<br />
als uneinträglichen Bearbeitung des Bodens war Spinnen und Weben der Haupterwerbszweig<br />
der Bewohner. Dies berichtet auch das Urbarium vom Jahre 1787. Eine andere Erwerbsquelle<br />
bot der ringsum liegende Wald. Manche beschäftigten sich mit der Verfertigung von allerlei<br />
hölzernen Gerätschaften, einzelne trieben Holzschnitzerei, andere arbeiteten mit dem<br />
Schleißenhobel. Die ganze Umgebung wurde aus Dörnikau mit Schleißen versorgt. Erst das<br />
Petroleum hat dieses primitive Beleuchtungsmaterial vollends verdrängt. - Für die<br />
Leinwandbleichen fabrizierte man Pottasche. Auch eine Glasschleifmühle war auf der Stelle<br />
No. 16 errichtet worden. Sie scheint nicht lange bestanden zu haben, da sie wohl mit anderen,<br />
den Glasfabriken näher liegenden Schleifmühlen nicht concurriren konnte. - Der Bergbau auf<br />
Silber, von dessen Betrieb auf dem zur Stelle No. 7 gehörenden Grundstück das Urbarium<br />
vom Jahre 1787 berichtet, dürfte wahrscheinlich nur ein vorübergehender Versuch gewesen<br />
sein. Die Spuren der betreffenden bergmännnischen Anlage sind noch vorhanden. Das<br />
Urbarium spricht von einem „ehemaligen Bergwerk, so aber völlig eingegangen." Das<br />
geförderte Erz war vielleicht Kupferschiefer, welcher etwas Silber enthielt. Das Vorhandensein<br />
6 lat. emolumentum „Gewinn"; Vorteil, Nutzen, <strong>hier</strong>: Nebeneinkünfte