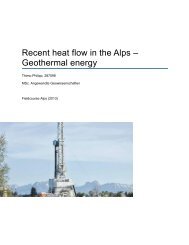von Johannes Schoenherr vorgelegt als Diplomarbeit am Institut für
von Johannes Schoenherr vorgelegt als Diplomarbeit am Institut für
von Johannes Schoenherr vorgelegt als Diplomarbeit am Institut für
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Kristallographische Vorzugsorientierungen <strong>von</strong> Quarz in den Phylliten aus Profil 1 belegen eine<br />
kristallplastische Deformation <strong>von</strong> Quarz in Scherzonennähe (siehe Abb. 4.9). Während Quarz in<br />
diesem Bereich duktil auf D A1 reagierte, ist zumeist eine bruchhafte Verformung mit Rissbildung<br />
in Feldspat zu beobachten. Die in Quarz-Feldspat-Schiefern und Phylliten enthaltenen<br />
Plagioklase zeigen Deformationszwillinge, undulöse Auslöschung, Mikrorisse und Knickbänder.<br />
Nur selten sind anhand <strong>von</strong> feinsuturierten Korngrenzen Merkmale einer<br />
Migrationsrekristallisation <strong>von</strong> Plagioklas entwickelt. Diese Deformationsmerkmale können aus<br />
einer vorwiegend kataklastischen Deformation durch Scherbruch mit stellenweise Übergang zu<br />
duktilem Verhalten in Feldspat bei Deformationstemperaturen <strong>von</strong> ca. 300-400 °C resultieren<br />
(nach PRYER 1993 2 ). Das gleichzeitige Auftreten <strong>von</strong> duktil deformiertem Quarz und zumeist<br />
spröde verformten Feldspat deutet auch nach PASSCHIER & TROUW (1998) auf<br />
Deformationstemperaturen <strong>von</strong> 300-400 °C bzw. auf untere grünschieferfazielle Bedingungen<br />
hin.<br />
Für die Entstehung der Mikrogefüge in den Met<strong>am</strong>orphiten aus dem Liegenden zur Ortler-Linie<br />
lässt sich schlussfolgernd eine Deformationstemperatur <strong>von</strong> ca. 300-400 °C ableiten.<br />
Wie bereits erwähnt, können außer den Dolomit-Myloniten die Gesteine aus Bereich I, III und<br />
IV in Profil 2 und aus Bereich II in Profil 3 <strong>als</strong> Scherzonengesteine interpretiert werden (mit<br />
Ausnahme der Rauhwacke und des Hauptdolomits).<br />
Vereinzelte Plagioklas-Gefüge der Quarz-Feldspat-Schiefer (JS-DA 33, 44, 49, 51, 62, 63)<br />
zeigen anhand der feinsuturierten Korngrenzen Anzeichen einer Migrationsrekristallisation des<br />
Plagioklases (z.B. Abb. 4.14, rechts und Abb. 4.20, links).<br />
2 Die <strong>von</strong> PRYER (1993) ermittelten Temperaturbereiche <strong>für</strong> die Bildung bestimmter Plagioklas-Mikrogefüge sind<br />
<strong>als</strong> Temperaturfelder zu verstehen, in welchen die beschriebenen Mikrogefüge <strong>am</strong> häufigsten auftreten. Die<br />
Bildungstemperatur eines bestimmten Mikrogefüges kann daher das angegebene Temperaturfeld über- und<br />
unterschreiten.<br />
Die Entstehung dieser Rekristallisationsgefüge geht nach FITZ GERALD & STÜNITZ (1993)<br />
und PRYER (1993) auf Deformationstemperaturen <strong>von</strong> ca. 450-500 °C zurück.<br />
Gleichzeitig zeigen die Quarz-Gefüge der Quarz-Feldspat-Schiefer und Phyllite Merkmale einer<br />
Rotationsrekristallisation (siehe Abb. 4.13 und 4.27). Dies weist nach STIPP et al. (2002) auf<br />
Deformationstemperaturen <strong>von</strong> ca. 400-500 °C hin.<br />
Die Korngrößen aus dem durch Subkornrotation rekristallisierten Quarz <strong>von</strong> JS-DA 44 und 62<br />
können nach BLENKINSOP (2000) <strong>als</strong> Paläopiezometer zur Bestimmung der