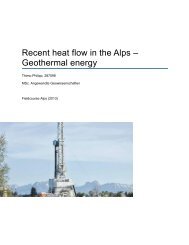von Johannes Schoenherr vorgelegt als Diplomarbeit am Institut für
von Johannes Schoenherr vorgelegt als Diplomarbeit am Institut für
von Johannes Schoenherr vorgelegt als Diplomarbeit am Institut für
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Abb. 4.53: Links (l.p.L.) weisen Dolomite aus einem grobkörnigen Bereich lobate Korngrenzen auf. Rechts zeigt<br />
sich innerhalb des Bereiches <strong>von</strong> links eine mehr oder weniger dominant ausgebildete Verzwillingung (g.p.L., lange<br />
Bildkante jeweils = 0,7 mm; beide Aufnahmen aus JS-DA 25)<br />
Die in Abb. 4.53 aufgenommenen Gang-Dolomite zeigen im KL-Bild eine engständige<br />
Zonierung mit vier- und dreieckiger Ausbildung (Abb. 4.54).<br />
Abb. 4.54: Im linken Bild wurde <strong>von</strong> Probe JS-DA 25.1 ein Ausschnitt aus den schiefwinklig zur L<strong>am</strong>ination<br />
stehenden Gängen unter l.p.L. aufgenommen. Die gangbildenden Dolomite zeigen im korrespondierendem KL-Bild<br />
rechts einen oszillierenden Zonarbau mit unterschiedlichen Intensitäten der Lumineszenz; lange Bildkante = 0,52<br />
mm<br />
Der mit der KL aufgenommene Gang ist Teil der großräumigen Veraderung des basalen<br />
Hauptdolomits. Die Körner sind hier durch einen „zickzack“-artigen Verlauf mit mehreren<br />
Zonierungen unterschiedlicher Lumineszenz gekennzeichnet.<br />
Die quantitative Korngefügeanalyse an Probe JS-DA 25 konnte zeigen, dass die<br />
durchschnittliche Korngröße des Hauptdolomits 70 mm 2 beträgt. Des Weiteren zeigt sich eine<br />
symmetrische und nahezu rundliche Ausbildung der gemittelten Kornform mit einer schwach<br />
ausgebildeten Verkürzung parallel zur L<strong>am</strong>ination (0-180°).