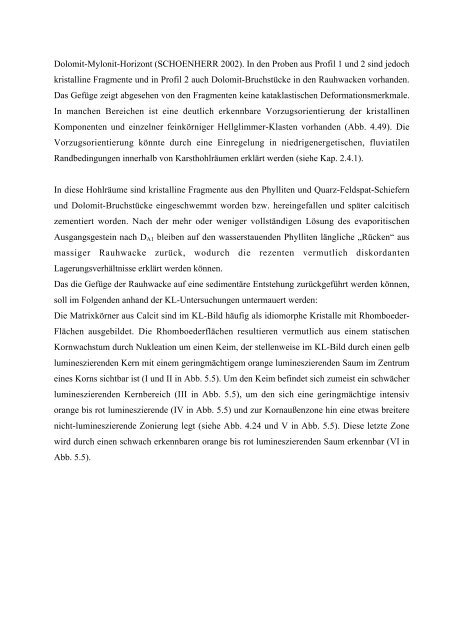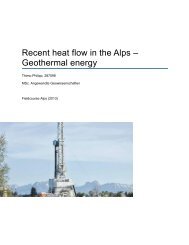von Johannes Schoenherr vorgelegt als Diplomarbeit am Institut für
von Johannes Schoenherr vorgelegt als Diplomarbeit am Institut für
von Johannes Schoenherr vorgelegt als Diplomarbeit am Institut für
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Dolomit-Mylonit-Horizont (SCHOENHERR 2002). In den Proben aus Profil 1 und 2 sind jedoch<br />
kristalline Fragmente und in Profil 2 auch Dolomit-Bruchstücke in den Rauhwacken vorhanden.<br />
Das Gefüge zeigt abgesehen <strong>von</strong> den Fragmenten keine kataklastischen Deformationsmerkmale.<br />
In manchen Bereichen ist eine deutlich erkennbare Vorzugsorientierung der kristallinen<br />
Komponenten und einzelner feinkörniger Hellglimmer-Klasten vorhanden (Abb. 4.49). Die<br />
Vorzugsorientierung könnte durch eine Einregelung in niedrigenergetischen, fluviatilen<br />
Randbedingungen innerhalb <strong>von</strong> Karsthohlräumen erklärt werden (siehe Kap. 2.4.1).<br />
In diese Hohlräume sind kristalline Fragmente aus den Phylliten und Quarz-Feldspat-Schiefern<br />
und Dolomit-Bruchstücke eingeschwemmt worden bzw. hereingefallen und später calcitisch<br />
zementiert worden. Nach der mehr oder weniger vollständigen Lösung des evaporitischen<br />
Ausgangsgestein nach D A1 bleiben auf den wasserstauenden Phylliten längliche „Rücken“ aus<br />
massiger Rauhwacke zurück, wodurch die rezenten vermutlich diskordanten<br />
Lagerungsverhältnisse erklärt werden können.<br />
Das die Gefüge der Rauhwacke auf eine sedimentäre Entstehung zurückgeführt werden können,<br />
soll im Folgenden anhand der KL-Untersuchungen untermauert werden:<br />
Die Matrixkörner aus Calcit sind im KL-Bild häufig <strong>als</strong> idiomorphe Kristalle mit Rhomboeder-<br />
Flächen ausgebildet. Die Rhomboederflächen resultieren vermutlich aus einem statischen<br />
Kornwachstum durch Nukleation um einen Keim, der stellenweise im KL-Bild durch einen gelb<br />
lumineszierenden Kern mit einem geringmächtigem orange lumineszierenden Saum im Zentrum<br />
eines Korns sichtbar ist (I und II in Abb. 5.5). Um den Keim befindet sich zumeist ein schwächer<br />
lumineszierenden Kernbereich (III in Abb. 5.5), um den sich eine geringmächtige intensiv<br />
orange bis rot lumineszierende (IV in Abb. 5.5) und zur Kornaußenzone hin eine etwas breitere<br />
nicht-lumineszierende Zonierung legt (siehe Abb. 4.24 und V in Abb. 5.5). Diese letzte Zone<br />
wird durch einen schwach erkennbaren orange bis rot lumineszierenden Saum erkennbar (VI in<br />
Abb. 5.5).