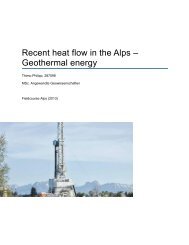von Johannes Schoenherr vorgelegt als Diplomarbeit am Institut für
von Johannes Schoenherr vorgelegt als Diplomarbeit am Institut für
von Johannes Schoenherr vorgelegt als Diplomarbeit am Institut für
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Der aus der Calcit-Matrix röntgenographisch ermittelte Illit- und Kaolinit-Gehalt resultiert<br />
vermutlich aus dem Abbau met<strong>am</strong>orpher Hellglimmer- und/oder Feldspat-Porphyroklasten unter<br />
hydrischen und sauren Verwitterungsbedingungen.<br />
Zum hangenden Hauptdolomit ergibt sich unter Berücksichtigung der Untersuchungen <strong>von</strong><br />
THÖNI (1983), KÜRMANN (1993), HENRICHS (1993) und BERRA & CIRILLI (1997), die<br />
an den mesozoischen Sedimenten der östlichen Ortler-Decke eoalpine Temperaturen <strong>von</strong> ca. 300<br />
°C ermittelten, ein Temperatursprung zu den eigentlichen Scherzonengesteinen. Es ist eine<br />
scharfe tektonische Grenze zwischen den duktil deformierten Dolomit-Myloniten und dem<br />
spröde verformten Hauptdolomit ausgebildet. Die Gefüge des Hauptdolomits enthalten makround<br />
mikroskopisch oftm<strong>als</strong> einen Versatz der sedimentären L<strong>am</strong>ination. Dieser Versatz ist stets<br />
mit der Ausbildung einer „Veraderung“ und Gangbildung aus Dolomitmineralen assoziiert (Abb.<br />
4.52).<br />
Die einzelnen Gänge laufen dabei zumeist in einem Bereich aus grobkörnigem Dolomit<br />
zus<strong>am</strong>men. Dort zeigt Dolomit (1) mehr oder weniger häufig auftretende Zwillingsbildung (siehe<br />
Abb. 4.53) und (2) einen Zonarbau im KL-Bild (siehe Abb. 4.54).<br />
In Anlehnung an SHELLEY (1993) (S. 353) bildeten sich die Zwillinge in den grobkörnigen<br />
Bereichen – in Übereinstimmung mit den <strong>von</strong> THÖNI (1983) und HENRICHS (1993)<br />
ermittelten eoalpinen Met<strong>am</strong>orphose-Temperaturen – bei Deformationstemperaturen <strong>von</strong> ca. 300<br />
°C (1).<br />
Die Gänge bildeten sich vermutlich durch die Zirkulation bzw. bei einem Überdruck durch<br />
heißer Fluide während D A1 , was zu einem sprödmechanischem Versatz der sedimentären<br />
L<strong>am</strong>ination führte. In dem durch den Fluidüberdruck entstandenen Ganghohlräumen zirkulierte<br />
eine min. 300 °C heiße Lösung, aus der sich zonierte Dolomite ausgefällt haben könnten (2).<br />
Einen Hinweis darauf, dass Fluide <strong>für</strong> die gangbildenden Prozesse verantwortlich sind, kann der<br />
Zonierungstyp <strong>von</strong> Dolomit im KL-Bild geben. Die Gangminerale des l<strong>am</strong>inierten<br />
Hauptdolomits zeigen im KL-Bild z.T. konzentrischen und z.T. oszillierenden Zonarbau (Abb.<br />
4.54), der sich nach MACHEL in PAGEL et al. (2000) in einem diffusionskontrollierten<br />
disäquilibrierten Mikrosystem auf wachsenden Kristalloberflächen bildet. Der hauptsächlich <strong>für</strong><br />
die KL in Karbonaten verantwortliche Mn 2+ -Gehalt muss über die Fluide in die Basallagen des<br />
Hauptdolomits eingetragen worden sein. Die zahlreichen geringmächtigen Zonierungen<br />
einzelner Dolomitminerale sind durch ein schwach lumineszierendes Zentrum charakterisiert,<br />
das bis zum Außenrand intensiver lumineszierend wird. Dies ist vermutlich auf eine während der<br />
Kristallisation ansteigende Anreicherung des Mn 2+ -Gehaltes in dem Fluid zurückzuführen.