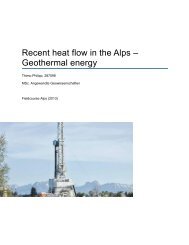von Johannes Schoenherr vorgelegt als Diplomarbeit am Institut für
von Johannes Schoenherr vorgelegt als Diplomarbeit am Institut für
von Johannes Schoenherr vorgelegt als Diplomarbeit am Institut für
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
(siehe Abb. 4.27). Während der Ausfällung bzw. Kristallisation wurde Albit syntektonisch durch<br />
D A1 formgeregelt.<br />
In der Literatur gibt es nur wenige vergleichbare Untersuchungen, die über die P/T-Bedingungen<br />
<strong>für</strong> das duktile Verhalten <strong>von</strong> Dolomit und über (met<strong>am</strong>orphe) Rekristallisationsprozesse in<br />
Dolomit handeln. MOLLI et al. (1990) leiteten Temperatur-Bedingungen in einem<br />
grünschieferfaziellen Calcit- und Dolomit-führenden Marmor über die Calcit/Dolomit-<br />
Thermometrie ab. Diese Probe zeigte Merkmale einer dyn<strong>am</strong>ischen Rekristallisation,<br />
Verzwillingung und einer kristallographisch bevorzugten Orientierung. Die Analyse an Proben<br />
mit Korngrößen zwischen 0,02 mm bis 0,05 mm erbrachte Temperaturen um 350° C. Die<br />
Analyse <strong>von</strong> Proben mit Korngrößen zwischen 0,1 mm bis 0,2 mm ergab Temperaturen <strong>von</strong><br />
380°-390° C. Nach KRUHL (1993) beginnt bei P-Bedingungen <strong>von</strong> ca. 7-9 kbar die dyn<strong>am</strong>ische<br />
Rekristallisation <strong>von</strong> Dolomit bei Temperaturen <strong>von</strong> 450°-480° C. Anhand <strong>von</strong> Untersuchungen<br />
an Dolomit-Einzelkristallen ermittelte WENK (1985) eine Temperatur <strong>von</strong> 400-500 °C <strong>für</strong> den<br />
Beginn des kristallplastischen Verhaltens <strong>von</strong> Dolomit.<br />
Die zuletzt genannten Daten werden durch Kompressionsversuche <strong>von</strong> HIGGS & HANDIN<br />
(1959) untermauert: Dabei wurden Dolomit-Einzelkristalle unter trockenen Bedingungen bei<br />
konstanten Verformungsraten <strong>von</strong> 1% pro Minute und Druckbedingungen bis zu 5 kbar u.a.<br />
senkrecht zur Foliation komprimiert. Bei Temperaturerhöhung <strong>von</strong> 24° C bis 500 °C k<strong>am</strong> es in<br />
den meisten Proben zum Kohäsionsverlust bis zu einer Temperatur <strong>von</strong> 400 °C. Ab dieser<br />
Temperatur setzte plötzlich das duktile Verhalten in Dolomit ein, das bei ca. 500 °C <strong>von</strong><br />
Zwillingsbildung begleitet wurde (siehe SHELLEY 1993).<br />
Aus diesen Ergebnissen wird ersichtlich, dass der spröd-duktile Übergangsbereich <strong>für</strong> Dolomit<br />
bei ca. 400 °C anzusetzen ist. Das Initi<strong>als</strong>tadium der dyn<strong>am</strong>ischen Rekristallisation <strong>von</strong> Dolomit<br />
ist u.a. <strong>von</strong> den Par<strong>am</strong>etern der Korngröße und des Druckes abhängig und kann nach den<br />
Untersuchungen <strong>von</strong> MOLLI et al. (1990) und KRUHL (1993) annähernd zwischen 350° C bis<br />
450° C eingeordnet werden.<br />
Das Mikrogefüge der Dolomit-Mylonite aus der Ortler-Linie ist (1) durch die ultrafeinkörnige<br />
Matrix der Dolomit-Mylonite und zum anderen durch die in (1) eingebetteten Dolomit-Klasten<br />
bzw. Boudins (2) charakterisiert. Die in Kap. 4.5.2.2 beschriebenen Klast/Matrix-Gefüge (siehe<br />
Abb. 4.36) resultieren aus einem Umfließen der Matrixminerale um die Dolomit-Klasten (nach<br />
LEISS & BARBER 1999).<br />
Die Dolomite innerhalb der Klasten zeigen zumeist feinsuturierte Korngrenzen, die sich<br />
vermutlich durch dyn<strong>am</strong>ische Migrationsrekristallisation während D A1 bildeten (siehe Abb. 4.44,<br />
links). Im KL-Bild zeigen die Dolomitkörner der Klasten zumeist eine fleckige gesprenkelte