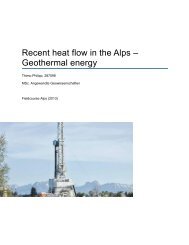von Johannes Schoenherr vorgelegt als Diplomarbeit am Institut für
von Johannes Schoenherr vorgelegt als Diplomarbeit am Institut für
von Johannes Schoenherr vorgelegt als Diplomarbeit am Institut für
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Lumineszenz, die nach MACHEL in PAGEL et al. (2000) durch Rekristallisationsprozesse<br />
verursacht werden kann. Z.T. sind die klastenbildenden Körner mit einer violetten bzw. vom<br />
Zentrum nach Außen intensiver werdenden Lumineszenz (Zonierung?) versehen. An den<br />
Außenzonen der Körner zeichnet die Lumineszenz die feinsuturierten Korngrenzen nach. Dieses<br />
Gefüge könnte zeigen, dass die Dolomit-Klasten zunächst rigide bzw. spröde auf die Scherung<br />
reagierten. Nach der Kornzerkleinerung der Klasten rekristallisierten die Einzelkörner randlich,<br />
wodurch sich lobate Korngrenzen ausbildeten (siehe Abb. 4.38). Eine kristallplastische<br />
Deformation der Dolomit-Mylonite aus der Ortler-Linie mit kristallographisch bevorzugter<br />
Orientierung wird durch Röntgentextur-Messungen <strong>von</strong> CONTI (1997) an einer Dolomit-<br />
Mylonit-Probe aus Profil 3 nachgewiesen.<br />
In den Dolomit-Klasten der Dolomit-Mylonite und im gelben Dolomit aus Profil 3 (JS-DA 59)<br />
enthalten überwiegend alle Körner Verzwillingungen (siehe Abb. 4.36 und Abb. 4.29).<br />
Nach SHELLEY (1993) bilden sich Zwillinge in Dolomit nicht unter Temperaturen <strong>von</strong> ca. 300<br />
°C, bis Temperaturen <strong>von</strong> ca. 400 °C sind diese nur schwach ausgebildet, während bei<br />
Temperaturen um 500 °C Zwillinge dominant auftreten.<br />
Nach den obigen Korrelationen der Mikrogefüge des Dolomit-Mylonits mit Literaturdaten wird<br />
eine Einordnung in das <strong>von</strong> WENK (1985) an Dolomit-Einzelkristallen ermittelte<br />
Temperaturfeld <strong>von</strong> 400-500 °C <strong>für</strong> das initiale duktile Verhalten <strong>von</strong> Dolomit möglich. Durch<br />
die dominant auftretende Zwillingsbildung (~ 500 °C) in den Dolomit-Klasten, der<br />
kristallplastischen Verformung (CONTI 1997) und der interpretierten dyn<strong>am</strong>ischen<br />
Migrationsrekristallisation in Dolomit-Klasten (~ 450° C) kann die Deformationstemperatur in<br />
den Dolomit-Myloniten während D A1 annähernd auf 400-500 °C eingegrenzt werden.<br />
Der aus EDX-Analysen ermittelte Phlogopit-Gehalt in den Dolomit-Myloniten kann nach<br />
TRÖGER (1969) aus einer Reaktion <strong>von</strong><br />
Dolomit + Feldspat _ Phlogopit oder Dolomit + Muskowit _ Phlogopit<br />
während der regionalmet<strong>am</strong>orphen Umkristallisation <strong>von</strong> Marmoren hervorgehen. Das Biotit-<br />
Endglied Phlogopit geht <strong>als</strong>o aus der Reaktion <strong>von</strong> karbonatischen Anteilen mit Detritus wie<br />
Quarz, Glimmer und Feldspat hervor. Dies könnte z.B. zeigen, dass sich das Protolith-Gestein<br />
des Dolomit-Mylonits in flachmarinen lagunären Verhältnissen bildete, in welchem es zum<br />
Eintrag <strong>von</strong> terrigenem Material (Detritus) aus dem Hinterland k<strong>am</strong>.<br />
Der geringe Steinsalz-Gehalt der Dolomit-Mylonite könnte in Anlehnung an TROMMSDORFF<br />
et al. (1985) aus einer Anreicherung <strong>von</strong> salzwasserhaltigen Fluiden während D A1 hervorgehen.<br />
Durch eine erhöhte Abfuhr <strong>von</strong> H 2 O während met<strong>am</strong>orpher Prozesse kann es zu einer Änderung<br />
der Fluidzus<strong>am</strong>mensetzung kommen, die sich durch Akkumulation <strong>von</strong> Salz im residualen Fluid