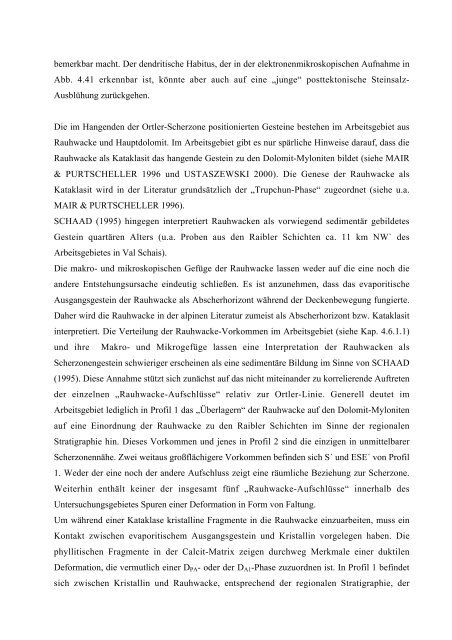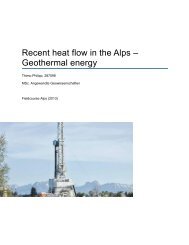von Johannes Schoenherr vorgelegt als Diplomarbeit am Institut für
von Johannes Schoenherr vorgelegt als Diplomarbeit am Institut für
von Johannes Schoenherr vorgelegt als Diplomarbeit am Institut für
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
emerkbar macht. Der dendritische Habitus, der in der elektronenmikroskopischen Aufnahme in<br />
Abb. 4.41 erkennbar ist, könnte aber auch auf eine „junge“ posttektonische Steinsalz-<br />
Ausblühung zurückgehen.<br />
Die im Hangenden der Ortler-Scherzone positionierten Gesteine bestehen im Arbeitsgebiet aus<br />
Rauhwacke und Hauptdolomit. Im Arbeitsgebiet gibt es nur spärliche Hinweise darauf, dass die<br />
Rauhwacke <strong>als</strong> Kataklasit das hangende Gestein zu den Dolomit-Myloniten bildet (siehe MAIR<br />
& PURTSCHELLER 1996 und USTASZEWSKI 2000). Die Genese der Rauhwacke <strong>als</strong><br />
Kataklasit wird in der Literatur grundsätzlich der „Trupchun-Phase“ zugeordnet (siehe u.a.<br />
MAIR & PURTSCHELLER 1996).<br />
SCHAAD (1995) hingegen interpretiert Rauhwacken <strong>als</strong> vorwiegend sedimentär gebildetes<br />
Gestein quartären Alters (u.a. Proben aus den Raibler Schichten ca. 11 km NW` des<br />
Arbeitsgebietes in Val Schais).<br />
Die makro- und mikroskopischen Gefüge der Rauhwacke lassen weder auf die eine noch die<br />
andere Entstehungsursache eindeutig schließen. Es ist anzunehmen, dass das evaporitische<br />
Ausgangsgestein der Rauhwacke <strong>als</strong> Abscherhorizont während der Deckenbewegung fungierte.<br />
Daher wird die Rauhwacke in der alpinen Literatur zumeist <strong>als</strong> Abscherhorizont bzw. Kataklasit<br />
interpretiert. Die Verteilung der Rauhwacke-Vorkommen im Arbeitsgebiet (siehe Kap. 4.6.1.1)<br />
und ihre Makro- und Mikrogefüge lassen eine Interpretation der Rauhwacken <strong>als</strong><br />
Scherzonengestein schwieriger erscheinen <strong>als</strong> eine sedimentäre Bildung im Sinne <strong>von</strong> SCHAAD<br />
(1995). Diese Annahme stützt sich zunächst auf das nicht miteinander zu korrelierende Auftreten<br />
der einzelnen „Rauhwacke-Aufschlüsse“ relativ zur Ortler-Linie. Generell deutet im<br />
Arbeitsgebiet lediglich in Profil 1 das „Überlagern“ der Rauhwacke auf den Dolomit-Myloniten<br />
auf eine Einordnung der Rauhwacke zu den Raibler Schichten im Sinne der regionalen<br />
Stratigraphie hin. Dieses Vorkommen und jenes in Profil 2 sind die einzigen in unmittelbarer<br />
Scherzonennähe. Zwei weitaus großflächigere Vorkommen befinden sich S´ und ESE´ <strong>von</strong> Profil<br />
1. Weder der eine noch der andere Aufschluss zeigt eine räumliche Beziehung zur Scherzone.<br />
Weiterhin enthält keiner der insges<strong>am</strong>t fünf „Rauhwacke-Aufschlüsse“ innerhalb des<br />
Untersuchungsgebietes Spuren einer Deformation in Form <strong>von</strong> Faltung.<br />
Um während einer Kataklase kristalline Fragmente in die Rauhwacke einzuarbeiten, muss ein<br />
Kontakt zwischen evaporitischem Ausgangsgestein und Kristallin vorgelegen haben. Die<br />
phyllitischen Fragmente in der Calcit-Matrix zeigen durchweg Merkmale einer duktilen<br />
Deformation, die vermutlich einer D PA - oder der D A1 -Phase zuzuordnen ist. In Profil 1 befindet<br />
sich zwischen Kristallin und Rauhwacke, entsprechend der regionalen Stratigraphie, der