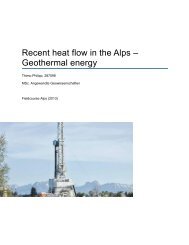von Johannes Schoenherr vorgelegt als Diplomarbeit am Institut für
von Johannes Schoenherr vorgelegt als Diplomarbeit am Institut für
von Johannes Schoenherr vorgelegt als Diplomarbeit am Institut für
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
3.2 Kathodolumineszenz (KL)<br />
3.2.1 Ziel<br />
Zur Rekonstruktion der mineral- und gesteinsbildenden Prozesse der Scherzonengesteine aus<br />
bzw. in Nähe der Ortler-Linie sollen Untersuchungen an insges<strong>am</strong>t fünf Proben im Geologischen<br />
<strong>Institut</strong> der Ruhr-Universität Bochum mit Hilfe der KL unter Anleitung <strong>von</strong> Dr. Rolf Neuser<br />
beitragen. Bei dieser Methode reagieren die Minerale eines polierten und bed<strong>am</strong>pften<br />
Dünnschliffes unter Elektronenbeschuss mit der Emission <strong>von</strong> Licht (Lumineszenz).<br />
Die Lumineszenz ist dabei abhängig vom Chemismus, <strong>von</strong> Kristallbaufehlern und<br />
Gitterdefekten, wodurch man Aussagen zur Phasenquantifizierung und Internstrukturen einzelner<br />
Minerale treffen kann.<br />
3.2.2 Methodik<br />
Das KL-Instrument (HC 1-LM, entwickelt <strong>von</strong> Dr. Rolf Neuser) der Ruhr-Universität-Bochum<br />
ist <strong>für</strong> die Aufnahme <strong>von</strong> Digitalbildern mit dem Videok<strong>am</strong>era-System KAPPA DX30C<br />
verknüpft. Im Allgemeinen werden ein Beschleunigungspotential <strong>von</strong> 14 kV und Stromstärken<br />
zwischen 5 und 10 mA/mm 2 <strong>für</strong> die KL-Messungen angewendet. Die Integrationszeiten des KL-<br />
Spektrums liegen durchschnittlich zwischen 10 und 60 s.<br />
Sämtliche KL-Aufnahmen der Proben JS-DA 24, 25, 34, 37 und 57 wurden während eines<br />
kompletten Tages genommen. Wurde ein zu untersuchender Ausschnitt des Dünnschliffs<br />
ausgewählt, so wurde zunächst ein Digitalphoto unter linear polarisiertem Licht und dann das<br />
korrespondierende KL-Bild aufgenommen.<br />
3.3 Pulverdiffraktometrie<br />
Insges<strong>am</strong>t wurden an sechs Proben (JS-DA 24, 34 -2x-, 52, 57, 59 und 61) sieben Analysen mit<br />
dem Pulverdiffraktometer PW 1050 (<strong>von</strong> PHILIPS) im <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Angewandte<br />
Geowissenschaften der TU Darmstadt röntgenographisch ausgewertet. Diese Untersuchungen<br />
sollen die submikroskopische Phasenquantifizierung, die über das ESEM<br />
elektronenmikroskopisch gewonnenen Ergebnisse und die KL-Analysen unterstützen. Auch<br />
hierbei wurde im Wesentlichen die Matrix der Rauhwacken und der Dolomit-Mylonite<br />
untersucht.<br />
3.4 Quantitative Korngefügeauswertung<br />
3.4.1 Ziel<br />
Insges<strong>am</strong>t wurden fünf Proben (JS-DA 24, 25, 37, 57 und 61) mit der Bildanalyse DIAna V2<br />
(Digital Image Analysis) <strong>von</strong> <strong>Johannes</strong> Duyster im <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Angewandte Geowissenschaften