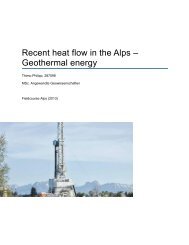von Johannes Schoenherr vorgelegt als Diplomarbeit am Institut für
von Johannes Schoenherr vorgelegt als Diplomarbeit am Institut für
von Johannes Schoenherr vorgelegt als Diplomarbeit am Institut für
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
glimmerreichen Lagen gebildet und umfließt Feldspat-Porphyroklasten, die eine prolate<br />
Verformungsgeometrie erkennen lassen. In den untersten Bereichen sind die Quarz-Feldspat-<br />
Schiefer chloritreicher <strong>als</strong> im hangenden Bereich.<br />
Stellenweise ist eine zweite Schieferung ausgebildet, die mit einem geringen Winkel zur<br />
Hauptfoliation steht. Letztere zeigt eine sehr uneinheitliche Orientierung vom Liegenden zum<br />
Hangenden: Die Hauptfoliation zeigt hier insges<strong>am</strong>t drei Maxima bei 302/20 (n = 11), bei 240/23<br />
(n = 14) und bei 151/30 (n = 8), wobei die einzelnen Maxima keinem Homogenbereich innerhalb<br />
<strong>von</strong> Bereich I zugeordnet werden können. Die Minerallineare zeigen ein konsistentes WNW-<br />
ESE Streichen (n = 16), während die beiden gemessenen Runzellineare mit flachen<br />
Einfallswinkeln einerseits nach NW und andererseits nach NE abtauchen.<br />
Die Phyllite i.w.S. werden im Liegenden <strong>von</strong> phyllitischen Quarz-Feldspat-Serizit-Schiefern<br />
aufgebaut, die zum Hangenden in die typischen Phyllite i.e.S. des Arbeitsgebietes übergehen.<br />
Die Quarz-Feldspat-Serizit-Schiefer heben sich durch ein deutlich feinkörnigeres Gefüge gegen<br />
die orthogenen Quarz-Feldspat-Schiefer ab. Sie zeigen eine engständige Foliation und einen<br />
geringen Glimmergehalt. Zum Hangenden <strong>von</strong> Bereich I werden die Phyllite chloritreicher.<br />
Die Phyllite fallen mit 40° nach W (260°) ein (n = 19), während die Minerallineare mit 20° sehr<br />
einheitlich nach WNW abtauchen.<br />
Insges<strong>am</strong>t zeigt sich <strong>für</strong> Bereich I ein dominierendes Einfallen in Richtung W mit<br />
Einfallswinkeln zwischen 20° und 40° und eine einheitliche Orientierung der Minerallineare in<br />
WNW-ESE-Richtung.<br />
4.4.2 Bereich II<br />
4.4.2.1 Makrogefüge<br />
Bereich II zeigt im Liegenden einen lithologischen Übergang zu Bereich I. Die Grenze wird <strong>als</strong><br />
Strukturgrenze definiert, da man eine etwa N-S gerichtete Faltung in Bereich II vom generell W-<br />
fallenden Lagenbau in Bereich I unterscheiden muss. Die östliche Grenze <strong>von</strong> Bereich II ist<br />
durch eine rot gestrichelte Linie in Profil 3 markiert, während im Westen die oben beschriebene<br />
1,20 m mächtige Abfolge in Bereich II miteinbezogen wird. Das Areal E´ und unterhalb der<br />
Tabaretta-Hütte wird aus einer Wechsellagerung <strong>von</strong> Quarz-Feldspat-Schiefern mit quarzitischen<br />
Einschaltungen und Phylliten aufgebaut.<br />
Diese Gesteine bilden einen NNE-SSW gerichteten Faltenbau ab. Der Nordschenkel fällt mit 27°<br />
nach NNE (017°) ein, während der Südschenkel mit 21° nach SSW (206°) einfällt (n = 17).<br />
Daraus ergibt sich eine rekonstruierte Faltenachse mit einem Wert <strong>von</strong> 291/02 und eine steil<br />
stehende Faltenachsenebene mit einem Wert <strong>von</strong> 201/87 (siehe Abb. 4.26). Die Minerallineare