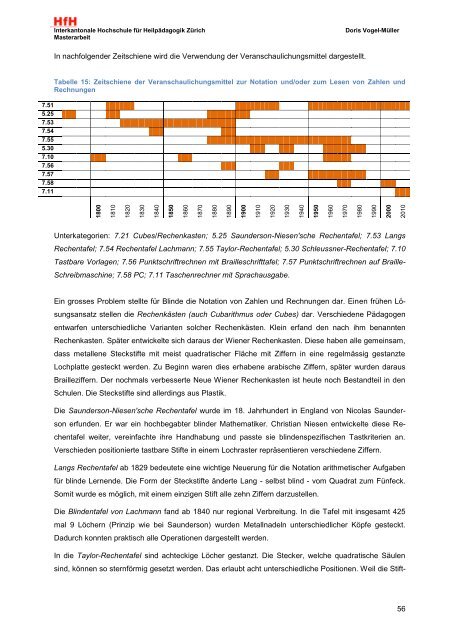Didaktische Konzepte und Veranschaulichungsmittel zum - BSCW
Didaktische Konzepte und Veranschaulichungsmittel zum - BSCW
Didaktische Konzepte und Veranschaulichungsmittel zum - BSCW
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
7.51<br />
5.25<br />
7.53<br />
7.54<br />
7.55<br />
5.30<br />
7.10<br />
7.56<br />
7.57<br />
7.58<br />
7.11<br />
Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich Doris Vogel-Müller<br />
Masterarbeit<br />
In nachfolgender Zeitschiene wird die Verwendung der <strong>Veranschaulichungsmittel</strong> dargestellt.<br />
Tabelle 15: Zeitschiene der <strong>Veranschaulichungsmittel</strong> zur Notation <strong>und</strong>/oder <strong>zum</strong> Lesen von Zahlen <strong>und</strong><br />
Rechnungen<br />
1800<br />
1810<br />
1820<br />
1830<br />
1840<br />
1850<br />
1860<br />
1870<br />
1880<br />
1890<br />
Unterkategorien: 7.21 Cubes/Rechenkasten; 5.25 Sa<strong>und</strong>erson-Niesen'sche Rechentafel; 7.53 Langs<br />
Rechentafel; 7.54 Rechentafel Lachmann; 7.55 Taylor-Rechentafel; 5.30 Schleussner-Rechentafel; 7.10<br />
Tastbare Vorlagen; 7.56 Punktschriftrechnen mit Brailleschrifttafel; 7.57 Punktschriftrechnen auf Braille-<br />
Schreibmaschine; 7.58 PC; 7.11 Taschenrechner mit Sprachausgabe.<br />
Ein grosses Problem stellte für Blinde die Notation von Zahlen <strong>und</strong> Rechnungen dar. Einen frühen Lö-<br />
sungsansatz stellen die Rechenkästen (auch Cubarithmus oder Cubes) dar. Verschiedene Pädagogen<br />
entwarfen unterschiedliche Varianten solcher Rechenkästen. Klein erfand den nach ihm benannten<br />
Rechenkasten. Später entwickelte sich daraus der Wiener Rechenkasten. Diese haben alle gemeinsam,<br />
dass metallene Steckstifte mit meist quadratischer Fläche mit Ziffern in eine regelmässig gestanzte<br />
Lochplatte gesteckt werden. Zu Beginn waren dies erhabene arabische Ziffern, später wurden daraus<br />
Brailleziffern. Der nochmals verbesserte Neue Wiener Rechenkasten ist heute noch Bestandteil in den<br />
Schulen. Die Steckstifte sind allerdings aus Plastik.<br />
Die Sa<strong>und</strong>erson-Niesen'sche Rechentafel wurde im 18. Jahrh<strong>und</strong>ert in England von Nicolas Sa<strong>und</strong>er-<br />
son erf<strong>und</strong>en. Er war ein hochbegabter blinder Mathematiker. Christian Niesen entwickelte diese Re-<br />
chentafel weiter, vereinfachte ihre Handhabung <strong>und</strong> passte sie blindenspezifischen Tastkriterien an.<br />
Verschieden positionierte tastbare Stifte in einem Lochraster repräsentieren verschiedene Ziffern.<br />
Langs Rechentafel ab 1829 bedeutete eine wichtige Neuerung für die Notation arithmetischer Aufgaben<br />
für blinde Lernende. Die Form der Steckstifte änderte Lang - selbst blind - vom Quadrat <strong>zum</strong> Fünfeck.<br />
Somit wurde es möglich, mit einem einzigen Stift alle zehn Ziffern darzustellen.<br />
Die Blindentafel von Lachmann fand ab 1840 nur regional Verbreitung. In die Tafel mit insgesamt 425<br />
mal 9 Löchern (Prinzip wie bei Sa<strong>und</strong>erson) wurden Metallnadeln unterschiedlicher Köpfe gesteckt.<br />
Dadurch konnten praktisch alle Operationen dargestellt werden.<br />
In die Taylor-Rechentafel sind achteckige Löcher gestanzt. Die Stecker, welche quadratische Säulen<br />
sind, können so sternförmig gesetzt werden. Das erlaubt acht unterschiedliche Positionen. Weil die Stift-<br />
1900<br />
1910<br />
1920<br />
1930<br />
1940<br />
1950<br />
1960<br />
1970<br />
1980<br />
1990<br />
2000<br />
2010<br />
56