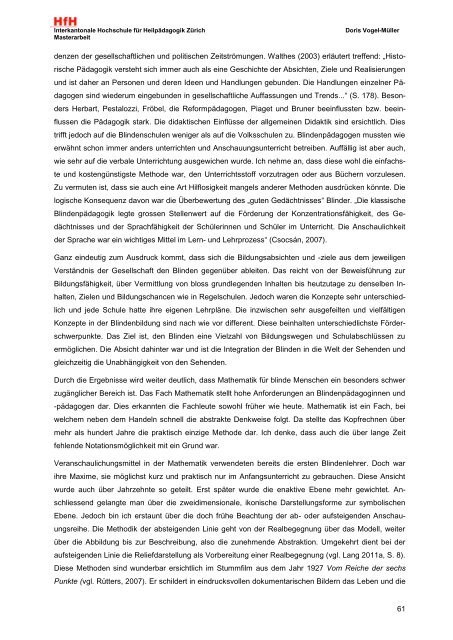Didaktische Konzepte und Veranschaulichungsmittel zum - BSCW
Didaktische Konzepte und Veranschaulichungsmittel zum - BSCW
Didaktische Konzepte und Veranschaulichungsmittel zum - BSCW
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich Doris Vogel-Müller<br />
Masterarbeit<br />
denzen der gesellschaftlichen <strong>und</strong> politischen Zeitströmungen. Walthes (2003) erläutert treffend: „Histo-<br />
rische Pädagogik versteht sich immer auch als eine Geschichte der Absichten, Ziele <strong>und</strong> Realisierungen<br />
<strong>und</strong> ist daher an Personen <strong>und</strong> deren Ideen <strong>und</strong> Handlungen geb<strong>und</strong>en. Die Handlungen einzelner Pä-<br />
dagogen sind wiederum eingeb<strong>und</strong>en in gesellschaftliche Auffassungen <strong>und</strong> Trends...“ (S. 178). Beson-<br />
ders Herbart, Pestalozzi, Fröbel, die Reformpädagogen, Piaget <strong>und</strong> Bruner beeinflussten bzw. beein-<br />
flussen die Pädagogik stark. Die didaktischen Einflüsse der allgemeinen Didaktik sind ersichtlich. Dies<br />
trifft jedoch auf die Blindenschulen weniger als auf die Volksschulen zu. Blindenpädagogen mussten wie<br />
erwähnt schon immer anders unterrichten <strong>und</strong> Anschauungsunterricht betreiben. Auffällig ist aber auch,<br />
wie sehr auf die verbale Unterrichtung ausgewichen wurde. Ich nehme an, dass diese wohl die einfachs-<br />
te <strong>und</strong> kostengünstigste Methode war, den Unterrichtsstoff vorzutragen oder aus Büchern vorzulesen.<br />
Zu vermuten ist, dass sie auch eine Art Hilflosigkeit mangels anderer Methoden ausdrücken könnte. Die<br />
logische Konsequenz davon war die Überbewertung des „guten Gedächtnisses“ Blinder. „Die klassische<br />
Blindenpädagogik legte grossen Stellenwert auf die Förderung der Konzentrationsfähigkeit, des Ge-<br />
dächtnisses <strong>und</strong> der Sprachfähigkeit der Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler im Unterricht. Die Anschaulichkeit<br />
der Sprache war ein wichtiges Mittel im Lern- <strong>und</strong> Lehrprozess“ (Csocsán, 2007).<br />
Ganz eindeutig <strong>zum</strong> Ausdruck kommt, dass sich die Bildungsabsichten <strong>und</strong> -ziele aus dem jeweiligen<br />
Verständnis der Gesellschaft den Blinden gegenüber ableiten. Das reicht von der Beweisführung zur<br />
Bildungsfähigkeit, über Vermittlung von bloss gr<strong>und</strong>legenden Inhalten bis heutzutage zu denselben In-<br />
halten, Zielen <strong>und</strong> Bildungschancen wie in Regelschulen. Jedoch waren die <strong>Konzepte</strong> sehr unterschied-<br />
lich <strong>und</strong> jede Schule hatte ihre eigenen Lehrpläne. Die inzwischen sehr ausgefeilten <strong>und</strong> vielfältigen<br />
<strong>Konzepte</strong> in der Blindenbildung sind nach wie vor different. Diese beinhalten unterschiedlichste Förder-<br />
schwerpunkte. Das Ziel ist, den Blinden eine Vielzahl von Bildungswegen <strong>und</strong> Schulabschlüssen zu<br />
ermöglichen. Die Absicht dahinter war <strong>und</strong> ist die Integration der Blinden in die Welt der Sehenden <strong>und</strong><br />
gleichzeitig die Unabhängigkeit von den Sehenden.<br />
Durch die Ergebnisse wird weiter deutlich, dass Mathematik für blinde Menschen ein besonders schwer<br />
zugänglicher Bereich ist. Das Fach Mathematik stellt hohe Anforderungen an Blindenpädagoginnen <strong>und</strong><br />
-pädagogen dar. Dies erkannten die Fachleute sowohl früher wie heute. Mathematik ist ein Fach, bei<br />
welchem neben dem Handeln schnell die abstrakte Denkweise folgt. Da stellte das Kopfrechnen über<br />
mehr als h<strong>und</strong>ert Jahre die praktisch einzige Methode dar. Ich denke, dass auch die über lange Zeit<br />
fehlende Notationsmöglichkeit mit ein Gr<strong>und</strong> war.<br />
<strong>Veranschaulichungsmittel</strong> in der Mathematik verwendeten bereits die ersten Blindenlehrer. Doch war<br />
ihre Maxime, sie möglichst kurz <strong>und</strong> praktisch nur im Anfangsunterricht zu gebrauchen. Diese Ansicht<br />
wurde auch über Jahrzehnte so geteilt. Erst später wurde die enaktive Ebene mehr gewichtet. An-<br />
schliessend gelangte man über die zweidimensionale, ikonische Darstellungsforme zur symbolischen<br />
Ebene. Jedoch bin ich erstaunt über die doch frühe Beachtung der ab- oder aufsteigenden Anschau-<br />
ungsreihe. Die Methodik der absteigenden Linie geht von der Realbegegnung über das Modell, weiter<br />
über die Abbildung bis zur Beschreibung, also die zunehmende Abstraktion. Umgekehrt dient bei der<br />
aufsteigenden Linie die Reliefdarstellung als Vorbereitung einer Realbegegnung (vgl. Lang 2011a, S. 8).<br />
Diese Methoden sind w<strong>und</strong>erbar ersichtlich im Stummfilm aus dem Jahr 1927 Vom Reiche der sechs<br />
Punkte (vgl. Rütters, 2007). Er schildert in eindrucksvollen dokumentarischen Bildern das Leben <strong>und</strong> die<br />
61