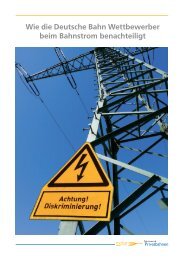Wettbewerber- Report Eisenbahn 2010/2011 - Mofair
Wettbewerber- Report Eisenbahn 2010/2011 - Mofair
Wettbewerber- Report Eisenbahn 2010/2011 - Mofair
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
so müssen sie hinnehmen, dass die DB AG<br />
fast immer die Frachtführerschaft und den<br />
Kundenkontakt zum Verlader anstrebt, so<br />
dass die Dritten in die faktische Rolle des<br />
Subunternehmers abgedrängt werden.<br />
Im Zweifel hat DB Schenker Rail die stärkere<br />
Verhandlungsposition: Während für<br />
den Marktführer die in Rede stehende<br />
Frachtmenge nur einen kleinen Teil des<br />
Geschäfts darstellt, der zur Not verzichtbar<br />
ist, kann dieses Aufkommen für die NE-<br />
Bahn einen wesentlichen Teil ihrer Existenz<br />
begründen. Es nimmt daher nicht wunder,<br />
dass von den kleinen Kooperationspartnern<br />
vielfach die Klage zu vernehmen ist, DB<br />
Schenker Rail reklamiere für den Hauptlauf<br />
einen überproportional hohen Anteil an<br />
der Vergütung, obwohl die Feinverteilung<br />
der Wagen durch die NE-Bahn deutlich höhere<br />
Kosten verursacht.<br />
Vorstöße von Wettbewerbsbahnen für die<br />
zweite Variante – den Aufbau eines eigenen<br />
Einzelwagenverkehrssystems – sind<br />
aufgrund der hohen Einstiegshürden bis<br />
dato an einer Hand abzuzählen. Wenn sie<br />
stattfanden, konzentrierten sie sich stets<br />
räumlich auf einen bestimmten Korridor<br />
oder auf die Vernetzung besonderer Aufkommensschwerpunkte.<br />
Solche Ansätze<br />
sind wegen der Abhängigkeit von sehr wenigen<br />
Großkunden äußerst fragil.<br />
Als Beispiele sind zu nennen:<br />
• das ehemalige »Chemliner«-Netz von<br />
log-o-rail/SETG, das heute von Transpetrol<br />
fortgeführt wird und einige Industrie<br />
cluster der Chemischen Industrie<br />
verknüpft<br />
• das von der EU bis 2012 geförderte<br />
Forschungs-/Kooperationsprojekt<br />
»ReTrack« auf der Achse Niederlande<br />
— Köln — Györ/Ungarn, an dem<br />
rund ein Dutzend Partner beteiligt sind,<br />
darunter mehrere EVU.<br />
• das junge Netzwerk von vier EVU unter<br />
der Führung von RAN, das Wagengruppen<br />
mit Schrott und Stahl zusammenstellt<br />
und diese zwischen dem Ruhrgebiet<br />
und Rumänien befördert.<br />
Den Sockel für solche Verkehre bildet<br />
eine gesicherte Grundauslastung durch einen<br />
oder wenige Großkunden in der jeweiligen<br />
Relation. Das zusätzliche Angebot der<br />
Einzelwagenbeförderung soll dann die Auslastung<br />
weiter heben.<br />
Inwieweit solche Netzwerke dauerhaft lebensfähig<br />
sind, wird maßgeblich von der<br />
Disziplin der Kooperationspartner (und<br />
deren Kunden) bestimmt, da das gesamte<br />
Produktionssystem starke wechselseitige<br />
Abhängigkeiten der Betriebsabwicklung<br />
bedingt. Die oft hohen Kundenerwartungen<br />
an die Verlässlichkeit der Beförderung<br />
sind zudem nur schwer zu erfüllen. Solange<br />
die Synergien im Hauptlauf nur dann<br />
zu erzielen sind, wenn die Güterwagen unterschiedlicher<br />
Verlader gebündelt werden<br />
können, steigt das Risiko für Verspätungen<br />
durch Warten auf bestimmte Zuführungen.<br />
Letztlich ist es unter den heutigen Voraussetzungen<br />
für die Wettbewerbsbahnen<br />
illusorisch, ein paralleles Einzelwagenverkehrssystem<br />
zu DB Schenker Rail zu errichten<br />
und zu betreiben, das die Kriterien der<br />
nationalen Flächenabdeckung und der internationalen<br />
Vernetzung erfüllt, so dass<br />
das Gesamtpaket einen vergleichbaren<br />
Qualitätsstandard aufbietet.<br />
Politischer Handlungsbedarf<br />
Aus verkehrspolitischer Sicht ist die gegenwärtige<br />
Situation unbefriedigend. DB<br />
Schenker Rail thront auf einem Monopol,<br />
das für Dritte nicht bestreitbar ist. Kreativer<br />
Wettbewerb um innovative Lösungen findet<br />
nicht statt, obwohl die Komplexität des<br />
Kirchturmdenken verhindert Kooperation<br />
Die Kooperationsbereitschaft der DB AG richtet sich teilweise an Kriterien aus, die nicht<br />
immer nachvollziehbar sind, in jedem Fall aber dem Gesamtsystem nicht dienlich sind. So<br />
hat DB Schenker Rail wenige Tage nach dem Verlust der ScandFibre-Verkehre an Captrain/<br />
SNCF die Kooperationsverträge mit allen regionalen Partnern gekündigt, die zu Captrain<br />
gehören. Seitdem fährt DB Schenker Rail z. B. seit <strong>2010</strong> mit eigenen Loks und eigenem Personal<br />
die Züge auf der Infrastruktur der Teutoburger Wald-<strong>Eisenbahn</strong>, die bis dahin als EVU<br />
über Jahrzehnte mit der DB AG zu beiderseitigem Nutzen kooperieren durfte. Beobachtern<br />
drängt sich der Eindruck auf, dass die Rivalität zur SNCF »auf der großen Bühne« stärker<br />
gewichtet wurde als die konkrete wirtschaftliche Situation vor Ort.<br />
112 <strong>Wettbewerber</strong>-<strong>Report</strong> <strong>Eisenbahn</strong> <strong>2010</strong>/<strong>2011</strong>