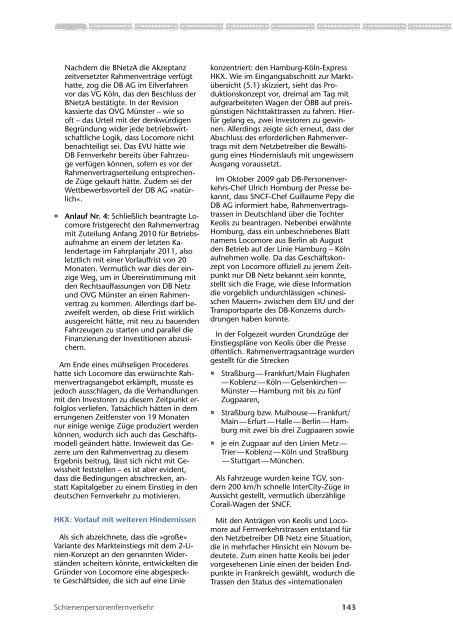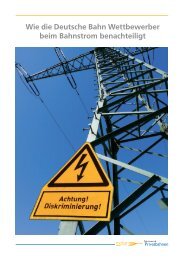Wettbewerber- Report Eisenbahn 2010/2011 - Mofair
Wettbewerber- Report Eisenbahn 2010/2011 - Mofair
Wettbewerber- Report Eisenbahn 2010/2011 - Mofair
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Nachdem die BNetzA die Akzeptanz<br />
zeitversetzter Rahmenverträge verfügt<br />
hatte, zog die DB AG im Eilverfahren<br />
vor das VG Köln, das den Beschluss der<br />
BNetzA bestätigte. In der Revision<br />
kassierte das OVG Münster – wie so<br />
oft – das Urteil mit der denkwürdigen<br />
Begründung wider jede betriebswirtschaftliche<br />
Logik, dass Locomore nicht<br />
benachteiligt sei. Das EVU hätte wie<br />
DB Fernverkehr bereits über Fahrzeuge<br />
verfügen können, sofern es vor der<br />
Rahmenvertragserteilung entsprechende<br />
Züge gekauft hätte. Zudem sei der<br />
Wettbewerbsvorteil der DB AG »natürlich«.<br />
• Anlauf Nr. 4: Schließlich beantragte Locomore<br />
fristgerecht den Rahmenvertrag<br />
mit Zuteilung Anfang <strong>2010</strong> für Betriebsaufnahme<br />
an einem der letzten Kalendertage<br />
im Fahrplanjahr <strong>2011</strong>, also<br />
letztlich mit einer Vorlauffrist von 20<br />
Monaten. Vermutlich war dies der einzige<br />
Weg, um in Übereinstimmung mit<br />
den Rechtsauffassungen von DB Netz<br />
und OVG Münster an einen Rahmenvertrag<br />
zu kommen. Allerdings darf bezweifelt<br />
werden, ob diese Frist wirklich<br />
ausgereicht hätte, mit neu zu bauenden<br />
Fahrzeugen zu starten und parallel die<br />
Finanzierung der Investitionen abzusichern.<br />
Am Ende eines mühseligen Procederes<br />
hatte sich Locomore das erwünschte Rahmenvertragsangebot<br />
erkämpft, musste es<br />
jedoch ausschlagen, da die Verhandlungen<br />
mit den Investoren zu diesem Zeitpunkt erfolglos<br />
verliefen. Tatsächlich hätten in dem<br />
errungenen Zeitfenster von 19 Monaten<br />
nur einige wenige Züge produziert werden<br />
können, wodurch sich auch das Geschäftsmodell<br />
geändert hätte. Inwieweit das Gezerre<br />
um den Rahmenvertrag zu diesem<br />
Ergebnis beitrug, lässt sich nicht mit Gewissheit<br />
feststellen – es ist aber evident,<br />
dass die Bedingungen abschrecken, anstatt<br />
Kapitalgeber zu einem Einstieg in den<br />
deutschen Fernverkehr zu motivieren.<br />
HKX: Vorlauf mit weiteren Hindernissen<br />
Als sich abzeichnete, dass die »große«<br />
Variante des Markteinstiegs mit dem 2-Linien-Konzept<br />
an den genannten Widerständen<br />
scheitern könnte, entwickelten die<br />
Gründer von Locomore eine abgespeckte<br />
Geschäftsidee, die sich auf eine Linie<br />
konzentriert: den Hamburg-Köln-Express<br />
HKX. Wie im Eingangsabschnitt zur Marktübersicht<br />
(5.1) skizziert, sieht das Produktionskonzept<br />
vor, dreimal am Tag mit<br />
aufgearbeiteten Wagen der ÖBB auf preisgünstigen<br />
Nichttakttrassen zu fahren. Hierfür<br />
gelang es, zwei Investoren zu gewinnen.<br />
Allerdings zeigte sich erneut, dass der<br />
Abschluss des erforderlichen Rahmenvertrags<br />
mit dem Netzbetreiber die Bewältigung<br />
eines Hindernislaufs mit ungewissem<br />
Ausgang voraussetzt.<br />
Im Oktober 2009 gab DB-Personenverkehrs-Chef<br />
Ulrich Homburg der Presse bekannt,<br />
dass SNCF-Chef Guillaume Pepy die<br />
DB AG informiert habe, Rahmenvertragstrassen<br />
in Deutschland über die Tochter<br />
Keolis zu beantragen. Nebenbei erwähnte<br />
Homburg, dass ein unbeschriebenes Blatt<br />
namens Locomore aus Berlin ab August<br />
den Betrieb auf der Linie Hamburg – Köln<br />
aufnehmen wolle. Da das Geschäftskonzept<br />
von Locomore offiziell zu jenem Zeitpunkt<br />
nur DB Netz bekannt sein konnte,<br />
stellt sich die Frage, wie diese Information<br />
die vorgeblich undurchlässigen »chinesischen<br />
Mauern« zwischen dem EIU und der<br />
Transportsparte des DB-Konzerns durchdrungen<br />
haben konnte.<br />
In der Folgezeit wurden Grundzüge der<br />
Einstiegspläne von Keolis über die Presse<br />
öffentlich. Rahmenvertragsanträge wurden<br />
gestellt für die Strecken<br />
• Straßburg — Frankfurt/Main Flughafen<br />
— Koblenz — Köln — Gelsenkirchen —<br />
Münster — Hamburg mit bis zu fünf<br />
Zugpaaren,<br />
• Straßburg bzw. Mulhouse — Frankfurt/<br />
Main — Erfurt — Halle — Berlin — Hamburg<br />
mit zwei bis drei Zugpaaren sowie<br />
• je ein Zugpaar auf den Linien Metz —<br />
Trier — Koblenz — Köln und Straßburg<br />
— Stuttgart — München.<br />
Als Fahrzeuge wurden keine TGV, sondern<br />
200 km/h schnelle InterCity-Züge in<br />
Aussicht gestellt, vermutlich überzählige<br />
Corail-Wagen der SNCF.<br />
Mit den Anträgen von Keolis und Locomore<br />
auf Fernverkehrstrassen entstand für<br />
den Netzbetreiber DB Netz eine Situation,<br />
die in mehrfacher Hinsicht ein Novum bedeutete.<br />
Zum einen hatte Keolis bei jeder<br />
vorgesehenen Linie einen der beiden Endpunkte<br />
in Frankreich gewählt, wodurch die<br />
Trassen den Status des »internationalen<br />
Schienenpersonenfernverkehr 143