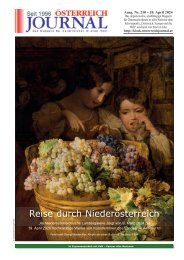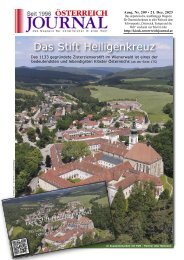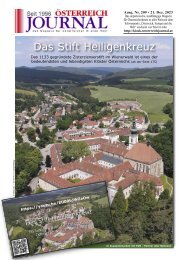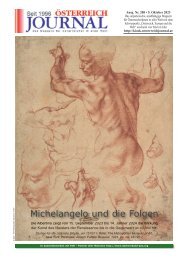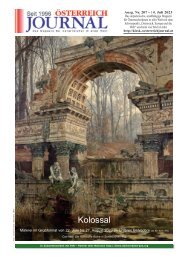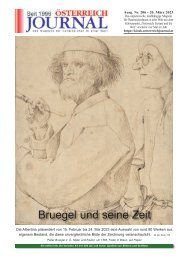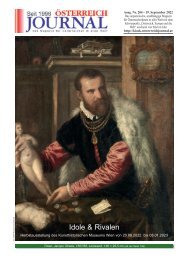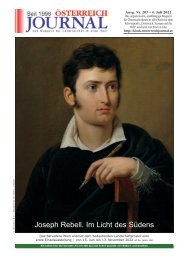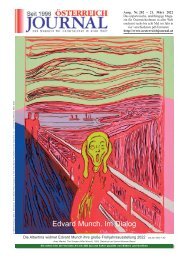Ausgabe 199
Magazin mit Berichten von der Politik bis zur Kultur: sechs Mal jährlich mit bis zu 145 Seiten Österreich. Downloads in vier verschiedenen pdf-Varianten auf http://oesterreichjournal.at/
Magazin mit Berichten von der Politik bis zur Kultur: sechs Mal jährlich mit bis zu 145 Seiten Österreich. Downloads in vier verschiedenen pdf-Varianten auf http://oesterreichjournal.at/
- Keine Tags gefunden...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
ÖSTERREICH JOURNAL NR. <strong>199</strong> / 22. 06. 2021<br />
Österreich, Europa und die Welt<br />
69<br />
Tagung. Das Institut für Verbrennungskraftmaschinen<br />
und Thermodynamik der TU<br />
Graz unter der Leitung von Univ.-Prof. Helmut<br />
Eichlseder, der jahrelang am Wasserstoffmotor<br />
etwa mit BMW forschte und entwickelte,<br />
liefert wertvolle Basisarbeit samt<br />
Testanalysen sowohl für Bosch wie für die<br />
AVL List und andere Unternehmen.<br />
Der Wasserstoffmotor basiert meist auf<br />
einem Diesel- oder Gasmotor, mit dem er<br />
sich laut Roberto Golisano, Punch Torino,<br />
rund 80 Prozent der Komponenten teilt. Speziell<br />
auf den Wasserstoffbetrieb ausgelegt<br />
werden müssen vor allem das Einspritzsystem,<br />
die Kurbelgehäuseentlüftung sowie das<br />
Zünd- und Motorsteuerungssystem. Zur Er -<br />
füllung anspruchsvollster Emissionsgrenzwerte<br />
braucht der Wasserstoffmotor – anders<br />
als der Brennstoffzellenantrieb – ein Abgasnachbehandlungssystem.<br />
Allerdings ist es<br />
we niger komplex als bei einem modernen<br />
Dieselmotor. Denn beim Verbrennungsprozeß<br />
von Wasserstoff entstehen nur geringe<br />
Mengen an Stickoxiden sowie ein winziger<br />
Ausstoß an Partikeln durch das Motoröl.<br />
Relativ zu sehen ist laut Andreas Kufferath<br />
von Bosch der schlechtere Wirkungsgrad<br />
des Wasserstoffmotors, den die Berliner<br />
Ingenieursgesellschaft Auto und Verkehr<br />
(IAV) in einer Vergleichsstudie mit max. 42<br />
Prozent gegenüber rund 55 Prozent beim<br />
Brennstoffzellenantrieb angibt. Denn die<br />
Brennstoffzelle kann ihren Wirkungsgradvorteil<br />
laut Bosch nur bei niedriger und mittlerer<br />
Last voll ausspielen, nicht aber bei Voll -<br />
last, weil sie sonst „überhitzt“, ihr Wärmemanagement<br />
überfordert. Der Wasserstoffmotor<br />
dagegen hat dieses Problem nicht.<br />
Gerade Schwernutzfahrzeuge und speziell<br />
Off-Highway-Fahrzeuge wie Minen-Lkw<br />
oder Landmaschinen sind oft im Volllastbetrieb<br />
unterwegs.<br />
Der Serienstart von Wasserstoff-Lkw<br />
könnte bereits 2024 erfolgen und so rasch<br />
zur CO 2 -Reduktion im Nutzfahrzeugbereich<br />
beitragen. MAN will laut Lukas Walter in<br />
seinem Vortrag noch heuer mit einem Test-<br />
Lkw starten.<br />
Brennstoffzellen-Lkw aus Asien<br />
Schwer-Lkw mit Brennstoffzellenantrieb<br />
sind bereits auf Europas Straßen unterwegs.<br />
Sie kommen vor allem aus Asien, von Großserien<br />
kann jedoch nicht die Rede sein. So<br />
bezieht das Schweizer Konsortium „H 2 Energy“<br />
seit 2020 Brennstoffzellen-Lkw (36-Ton -<br />
ner) von Hyundai. Derzeit sind 39 Lkw im<br />
Einsatz, bis Ende 2023 sollen es 1.000 sein.<br />
Sie tanken Druckwasserstoff mit 350 bar<br />
Foto: ÖVK<br />
Sektionsleiter Günter Hohenberg (TU Darmstadt) vor virtuellem Hintergrund Konferenz -<br />
zentrum Hofburg Vienna<br />
und schaffen eine Reichweite von rund 400<br />
Kilometern. Andere Hersteller wie Toyota,<br />
Daimler oder Nikola haben entsprechende<br />
Pläne angekündigt.<br />
Die Anforderungen eines Schwer-Lkw an<br />
den Brennstoffzellenantrieb unterscheiden<br />
sich stark von jenen eines Pkw. Für Lkw muß<br />
der Antrieb laut Christian Mohrdieck von<br />
der Firma Cellcentric etwa eine Lebensdauer<br />
von 25.000 Betriebsstunden erreichen, für<br />
Pkw reichen 8.000 Stunden.<br />
Frächter fordern zudem, daß der Brennstoffzellenantrieb<br />
auf das Preisniveau eines<br />
modernen Diesel- oder zumindest batterieelektrischen<br />
Antriebs kommt. Dies gilt vor<br />
2030 als wenig realistisch. Ein Grund hierfür<br />
sind der hohe Edelmetallbedarf des Systems<br />
und die noch geringen Produktionsmengen<br />
an Brennstoffzellen. Derzeit werden laut<br />
Marc Sens von der IAV weltweit erst ein<br />
paar tausend Brennstoffzellenstapel produziert,<br />
erst für 2030 wird mit einer Produktion<br />
von 500.000 Stück pro Jahr gerechnet, was<br />
den Preis stark drücken werde. Daneben gilt<br />
es auch noch den nötigen hohen Edelmetallbedarf<br />
des Systems zu senken.<br />
Laut Sens ist der Brennstoffzellenantrieb<br />
derzeit aber auch noch nicht robust genug<br />
für den internationalen Schwerverkehr. Da -<br />
neben unterliegt die Brennstoffzelle wie die<br />
Batterie einem Alterungsprozess, ihre Leistung<br />
nimmt mit der Einsatzdauer ab.<br />
Wasserstoffmotor als Türöffner<br />
Es gibt aber auch Herausforderungen und<br />
Vorteile, die sich der Wasserstoffmotor und<br />
der Brennstoffzellenantrieb teilen. Beide be -<br />
»Österreich Journal« – http://www.oesterreichjournal.at<br />
nötigen den Aufbau einer Wasserstoff-Infrastruktur.<br />
Wobei der Wasserstoffmotor dank<br />
schnellerer und früherer Marktdurchdringung<br />
den Türöffner spielen und Wasserstoff-<br />
Tankstellenbetreibern eine Mindestauslastung<br />
garantieren könnte.<br />
Anders als beim Laden von Batterien gibt<br />
es beim Wasserstoff einheitliche Tankstutzen,<br />
auch beim Abgabedruck hat sich der<br />
Markt auf 350 und 700 bar geeinigt – im Ge -<br />
gensatz zu der „Spannungsvielfalt“ an Ladesäulen.<br />
Das Wasserstofftanken ist für einen<br />
Fern-Lkw mit 1.000 km Reichweite in wenigen<br />
Minuten erledigt.<br />
Für den von Daimler favorisierten Flüssigwasserstoff<br />
gibt es noch keine Infrastruktur.<br />
Flüssigwasserstoff hat eine höhere Energiedichte<br />
als Druckwasserstoff, erlaubt so -<br />
mit bei gleichem Tankvolumen mehr Reichweite.<br />
Er muß jedoch permanent auf minus<br />
252 Grad C gekühlt werden, was sehr energieintensiv<br />
ist. Ein weiteres Problem sind die<br />
„Verdampfungsverluste“ von flüssigem Was -<br />
serstoff, was für Lkw wegen geringerer Stehzeiten<br />
jedoch als weniger heikel als für Pkw<br />
gilt. Einen entsprechenden Tank stellt Johannes<br />
Winklhofer von der Salzburger Aluminium<br />
Group (SAG) auf dem Motorensymposium<br />
vor. Die aufwendigen Tanks sind nach<br />
wie vor einer der größten Kostenfaktoren bei -<br />
der Antriebe und beeinflussen maßgeblich<br />
die Gesamtbetriebskosten, die für Frächter<br />
entscheidend sind.<br />
Christian Mohrdieck von Cellcentric fordert<br />
auch finanzielle Anreize durch die Politik.<br />
Die entscheidende Rolle wird jedoch der<br />
Preis von Wasserstoff spielen, vor allem vom