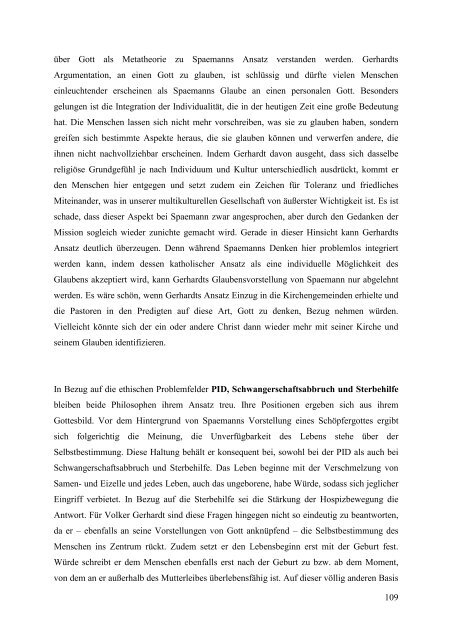Christina Kosbü - repOSitorium - Universität Osnabrück
Christina Kosbü - repOSitorium - Universität Osnabrück
Christina Kosbü - repOSitorium - Universität Osnabrück
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
über Gott als Metatheorie zu Spaemanns Ansatz verstanden werden. Gerhardts<br />
Argumentation, an einen Gott zu glauben, ist schlüssig und dürfte vielen Menschen<br />
einleuchtender erscheinen als Spaemanns Glaube an einen personalen Gott. Besonders<br />
gelungen ist die Integration der Individualität, die in der heutigen Zeit eine große Bedeutung<br />
hat. Die Menschen lassen sich nicht mehr vorschreiben, was sie zu glauben haben, sondern<br />
greifen sich bestimmte Aspekte heraus, die sie glauben können und verwerfen andere, die<br />
ihnen nicht nachvollziehbar erscheinen. Indem Gerhardt davon ausgeht, dass sich dasselbe<br />
religiöse Grundgefühl je nach Individuum und Kultur unterschiedlich ausdrückt, kommt er<br />
den Menschen hier entgegen und setzt zudem ein Zeichen für Toleranz und friedliches<br />
Miteinander, was in unserer multikulturellen Gesellschaft von äußerster Wichtigkeit ist. Es ist<br />
schade, dass dieser Aspekt bei Spaemann zwar angesprochen, aber durch den Gedanken der<br />
Mission sogleich wieder zunichte gemacht wird. Gerade in dieser Hinsicht kann Gerhardts<br />
Ansatz deutlich überzeugen. Denn während Spaemanns Denken hier problemlos integriert<br />
werden kann, indem dessen katholischer Ansatz als eine individuelle Möglichkeit des<br />
Glaubens akzeptiert wird, kann Gerhardts Glaubensvorstellung von Spaemann nur abgelehnt<br />
werden. Es wäre schön, wenn Gerhardts Ansatz Einzug in die Kirchengemeinden erhielte und<br />
die Pastoren in den Predigten auf diese Art, Gott zu denken, Bezug nehmen würden.<br />
Vielleicht könnte sich der ein oder andere Christ dann wieder mehr mit seiner Kirche und<br />
seinem Glauben identifizieren.<br />
In Bezug auf die ethischen Problemfelder PID, Schwangerschaftsabbruch und Sterbehilfe<br />
bleiben beide Philosophen ihrem Ansatz treu. Ihre Positionen ergeben sich aus ihrem<br />
Gottesbild. Vor dem Hintergrund von Spaemanns Vorstellung eines Schöpfergottes ergibt<br />
sich folgerichtig die Meinung, die Unverfügbarkeit des Lebens stehe über der<br />
Selbstbestimmung. Diese Haltung behält er konsequent bei, sowohl bei der PID als auch bei<br />
Schwangerschaftsabbruch und Sterbehilfe. Das Leben beginne mit der Verschmelzung von<br />
Samen- und Eizelle und jedes Leben, auch das ungeborene, habe Würde, sodass sich jeglicher<br />
Eingriff verbietet. In Bezug auf die Sterbehilfe sei die Stärkung der Hospizbewegung die<br />
Antwort. Für Volker Gerhardt sind diese Fragen hingegen nicht so eindeutig zu beantworten,<br />
da er – ebenfalls an seine Vorstellungen von Gott anknüpfend – die Selbstbestimmung des<br />
Menschen ins Zentrum rückt. Zudem setzt er den Lebensbeginn erst mit der Geburt fest.<br />
Würde schreibt er dem Menschen ebenfalls erst nach der Geburt zu bzw. ab dem Moment,<br />
von dem an er außerhalb des Mutterleibes überlebensfähig ist. Auf dieser völlig anderen Basis<br />
109