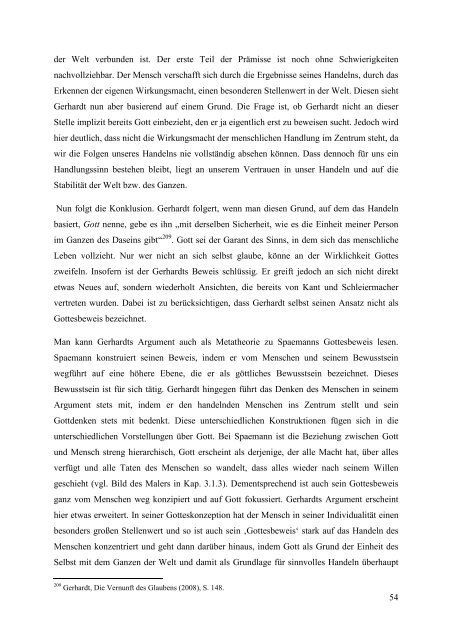Christina Kosbü - repOSitorium - Universität Osnabrück
Christina Kosbü - repOSitorium - Universität Osnabrück
Christina Kosbü - repOSitorium - Universität Osnabrück
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
der Welt verbunden ist. Der erste Teil der Prämisse ist noch ohne Schwierigkeiten<br />
nachvollziehbar. Der Mensch verschafft sich durch die Ergebnisse seines Handelns, durch das<br />
Erkennen der eigenen Wirkungsmacht, einen besonderen Stellenwert in der Welt. Diesen sieht<br />
Gerhardt nun aber basierend auf einem Grund. Die Frage ist, ob Gerhardt nicht an dieser<br />
Stelle implizit bereits Gott einbezieht, den er ja eigentlich erst zu beweisen sucht. Jedoch wird<br />
hier deutlich, dass nicht die Wirkungsmacht der menschlichen Handlung im Zentrum steht, da<br />
wir die Folgen unseres Handelns nie vollständig absehen können. Dass dennoch für uns ein<br />
Handlungssinn bestehen bleibt, liegt an unserem Vertrauen in unser Handeln und auf die<br />
Stabilität der Welt bzw. des Ganzen.<br />
Nun folgt die Konklusion. Gerhardt folgert, wenn man diesen Grund, auf dem das Handeln<br />
basiert, Gott nenne, gebe es ihn „mit derselben Sicherheit, wie es die Einheit meiner Person<br />
im Ganzen des Daseins gibt“ 209 . Gott sei der Garant des Sinns, in dem sich das menschliche<br />
Leben vollzieht. Nur wer nicht an sich selbst glaube, könne an der Wirklichkeit Gottes<br />
zweifeln. Insofern ist der Gerhardts Beweis schlüssig. Er greift jedoch an sich nicht direkt<br />
etwas Neues auf, sondern wiederholt Ansichten, die bereits von Kant und Schleiermacher<br />
vertreten wurden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Gerhardt selbst seinen Ansatz nicht als<br />
Gottesbeweis bezeichnet.<br />
Man kann Gerhardts Argument auch als Metatheorie zu Spaemanns Gottesbeweis lesen.<br />
Spaemann konstruiert seinen Beweis, indem er vom Menschen und seinem Bewusstsein<br />
wegführt auf eine höhere Ebene, die er als göttliches Bewusstsein bezeichnet. Dieses<br />
Bewusstsein ist für sich tätig. Gerhardt hingegen führt das Denken des Menschen in seinem<br />
Argument stets mit, indem er den handelnden Menschen ins Zentrum stellt und sein<br />
Gottdenken stets mit bedenkt. Diese unterschiedlichen Konstruktionen fügen sich in die<br />
unterschiedlichen Vorstellungen über Gott. Bei Spaemann ist die Beziehung zwischen Gott<br />
und Mensch streng hierarchisch, Gott erscheint als derjenige, der alle Macht hat, über alles<br />
verfügt und alle Taten des Menschen so wandelt, dass alles wieder nach seinem Willen<br />
geschieht (vgl. Bild des Malers in Kap. 3.1.3). Dementsprechend ist auch sein Gottesbeweis<br />
ganz vom Menschen weg konzipiert und auf Gott fokussiert. Gerhardts Argument erscheint<br />
hier etwas erweitert. In seiner Gotteskonzeption hat der Mensch in seiner Individualität einen<br />
besonders großen Stellenwert und so ist auch sein ‚Gottesbeweis‘ stark auf das Handeln des<br />
Menschen konzentriert und geht dann darüber hinaus, indem Gott als Grund der Einheit des<br />
Selbst mit dem Ganzen der Welt und damit als Grundlage für sinnvolles Handeln überhaupt<br />
209 Gerhardt, Die Vernunft des Glaubens (2008), S. 148.<br />
54