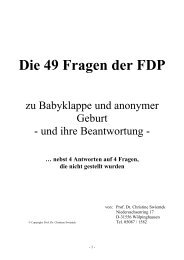Die soziale Konstruktion von Behinderung durch frühkindliche ...
Die soziale Konstruktion von Behinderung durch frühkindliche ...
Die soziale Konstruktion von Behinderung durch frühkindliche ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
5. Entwicklungspsychologie<br />
<strong>Die</strong> Wechselwirkungen zwischen Individuum und Umwelt zeigen sich in der<br />
Interaktion zwischen Kind und Mutter und Dialoge beginnen bereits vor der Geburt. <strong>Die</strong><br />
Bewegungsmuster, die erstmals um die 10. Embryonalwoche und dann verfeinert <strong>durch</strong><br />
höhere Hirnstrukturen um die 22. Woche erneut auftreten, verursachen Kontraktionen<br />
der Uteruswand und passen sich an diese an (vgl. Jantzen, 1987, S. 182; 2004a, S. 282).<br />
Schon bald nach der Geburt ist das Kind in der Lage so komplexe Zusammenhänge wie<br />
Emotion und Motive der Bezugsperson zu erkennen und darüber in Kommunikation zu<br />
treten. Im zweiten Monat beginnt das Kind das menschliche Gesicht des Gegenübers<br />
visuell wahrzunehmen. Über die zeitliche Struktur des Dialogs beginnt es Belebtes <strong>von</strong><br />
Unbelebtem zu unterscheiden. <strong>Die</strong> reziproken Rückkopplungsprozesse mit einer<br />
Bezugsperson führen zu Sicherheit und Bindung und ermöglichen die weitere<br />
psychische Entwicklung (ebda. 2004a). WALLON betont die Bedeutung der<br />
Emotionen, die diese auf den ersten Stufen der Entwicklung haben. Neben<br />
Wahrnehmungen und tonischer Muskelaktivität spielen sie die wichtigste Rolle bei der<br />
Kontaktaufnahme mit der Umwelt (vgl. Servet, 1999). Emotionaler Austausch kann als<br />
Grundlage für das Entstehen höherer Bewusstseinsgrade gesehen werden. Auch<br />
VYGOTSKIJ (2001) schreibt den Emotionen strukturbildende Funktionen zu, sie<br />
öffnen und schließen das Gehirn. Früher emotional abgesicherter Dialog mit einem<br />
freundlichen Begleiter bewirkt somit die Öffnung des Gehirns für die weitere<br />
Entwicklung des Kindes (vgl. Jantzen, 2004a, S. 283).<br />
5.1 Das Intrinsische Motivsystem und die Grundlagen für <strong>soziale</strong> Interaktion<br />
<strong>Die</strong> Voraussetzungen dafür, dass ein Kind sein Grundbedürfnis nach emotionalem und<br />
dialogischem Austausch nach der Geburt ausdrücken kann, werden bereits zwischen der<br />
5. und 8. Embryonalwoche gelegt. <strong>Die</strong> Neurowissenschaftler TREVARTHEN und<br />
AITKEN (1997, 2001) gehen da<strong>von</strong> aus, dass zu diesem Zeitpunkt bereits auf der<br />
untersten Ebene sich integrierender Stammhirnfunktionen ein intrinsisches Motivsystem<br />
(„Intrinsic Motive Formation“ IMF) entsteht. Sie beschreiben das IMF als eine Art<br />
Regulator, der Motive und Emotionen generiert, so dass sich zwischenmenschlicher<br />
Kontakt als Bedürfnis ausdrückt und Bindungen eingegangen werden können<br />
(Trevarthen/ Aitken, 1997).<br />
Sie postulieren, dass das neugeborene Kind auf der Grundlage des IMF bereits zum<br />
Zeitpunkt der Geburt in der Lage ist, mit den expressiven Emotionen des freundlichen<br />
Begleiters zu kooperieren, wobei in einer wechselseitigen Führung die Hirnentwicklung<br />
48