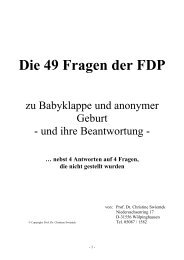Die soziale Konstruktion von Behinderung durch frühkindliche ...
Die soziale Konstruktion von Behinderung durch frühkindliche ...
Die soziale Konstruktion von Behinderung durch frühkindliche ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Adoptivkindern entweder <strong>durch</strong> einen höheren Grad kognitiver Beeinträchtigung<br />
und/oder <strong>durch</strong> eine längere Dauer schwerer psychischer und <strong>soziale</strong>r Deprivation.<br />
Bei drei Kindern vermuteten die Autoren Autismus, bei sieben anderen Kindern quasi-<br />
autistische Muster und bei weiteren zehn Kindern beobachteten sie schwächere, meist<br />
isolierte autistische Muster 14 .<br />
<strong>Die</strong> zuerst benannten drei Kinder zeigten sowohl mit vier als auch mit sechs Jahren alle<br />
Kriterien für Autismus. Bei allen drei Kindern war die Zeit der institutionellen<br />
Versorgung sehr lang, in zwei Fällen zudem ausgesprochen ärmlich. Ein Kind wuchs<br />
vollkommen isoliert auf, das zweite Kind war sehr schwer unterernährt und lebte in<br />
einem Heim, in dem eine große Anzahl <strong>von</strong> Kindern aus unbekannten Gründen noch<br />
vor dem 6. Lebensmonat verstarben, das dritte Kind wurde in der 26.<br />
Schwangerschaftswoche geboren, weitere Details waren nicht bekannt.<br />
<strong>Die</strong> sieben Kinder mit quasi-autistischen Mustern zeigten dagegen enorme<br />
Verbesserungen in der Entwicklung. Unterschieden sie sich mit vier Jahren nur <strong>durch</strong><br />
wenige aber doch einige atypische Merkmale <strong>von</strong> Gleichaltrigen mit Autismus, wurden<br />
die autismusähnlichen Anzeichen in den nächsten zwei Jahren immer schwächer. Als<br />
atypische Merkmale benennen RUTTER und seine Kollegen den relativ hohen Grad an<br />
Kontaktaufnahme zu anderen Menschen, den spontanen Einsatz der gesprochenen und<br />
der Zeichen-Sprache und die weniger ausgeprägten motorischen Stereotypien. <strong>Die</strong>ses<br />
Atypische, im Vergleich zum <strong>frühkindliche</strong>n Autismus, und der markante Rückgang der<br />
Anzeichen verleitete die Autoren zu der Bezeichnung des Syndroms als „quasi-<br />
autistisches Muster“ (ebda. S. 545).<br />
Bei den Kindern der Gruppe, die schwächere isolierte autistische Merkmale zeigten,<br />
erschien die Qualität zunächst ähnlich, jedoch in einem viel schwächeren Grad, so dass<br />
eine Zuteilung zu der zuvor benannten Gruppe nicht gerechtfertigt werden konnte.<br />
Unklar bleibt, ob diese schwächeren Anzeichen denselben Ursprüngen zuzuordnen sind<br />
oder ob unterschiedliche Ursachen vorliegen.<br />
Bei allen Kindern mit quasi-autistischen Merkmalen liegt ein signifikant längerer<br />
Heimaufenthalt (mindestens 12 Monate) vor. Darüber hinaus bietet RUTTER drei<br />
Erklärungsperspektiven zu den Ursprüngen des auffälligen Verhaltens an.<br />
14 Ich empfinde die Diagnose „Autismus“ an dieser Stelle und in der vorliegenden Studie als<br />
problematisch, das sich die Autoren scheinbar rein auf äußere Merkmale und Symptome beschränken und<br />
es meiner Meinung nach an einer theoretischen Auseinandersetzung fehlt. Ich verweise hierzu auf die<br />
Theorie des kindlichen Autismus nach TREVARTHEN/ AITKEN (1998), die als Ursache Störungen des<br />
Imitationsvermögens und der emotionalen Reziprozität annehmen, deren Grundlagen bereits im Aufbau<br />
des intrinsischen Motivationssystems (IMF) in Verbindung mit dem emotional-motorischen System<br />
(EMS) liegen (vgl. 5.1; Trevarthen/ Aitken, 1998, 1997; Jantzen, 2002b).<br />
64