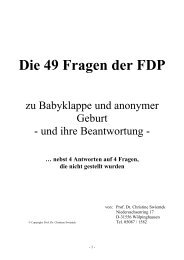Die soziale Konstruktion von Behinderung durch frühkindliche ...
Die soziale Konstruktion von Behinderung durch frühkindliche ...
Die soziale Konstruktion von Behinderung durch frühkindliche ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Motivsystem auf die Existenz eines freundlichen Begleiters ausgerichtet ist (vgl.<br />
Jantzen, 2001a).<br />
Anhand der Untersuchungen <strong>von</strong> René SPITZ wird deutlich, dass der Verlust einer<br />
engen Bezugsperson ein einschneidendes Erlebnis für die betroffenen Kinder darstellt.<br />
In Abhängigkeit <strong>von</strong> der vor der Trennung erfahrenen Beziehung und den bis zu dem<br />
Zeitpunkt entwickelten psychischen Strukturen, hat ein derart einschneidendes Erlebnis<br />
psychische und/oder physische Folgen für das Kind.<br />
6.2 Zur Wahrscheinlichkeit traumatischer Erfahrungen bei Adoptivkindern<br />
Welche Erfahrungen können nun als traumatisch und als eventuelle Auslöser für spätere<br />
Entwicklungsbeeinträchtigungen bestimmt werden? Von welchen Faktoren hängt die<br />
Bewertung eines Erlebnisses als derart einschneidend ab, dass die Bezeichnung des<br />
Traumas zutrifft?<br />
TERR (1991) unterscheidet zwei Typen <strong>von</strong> Traumata: Der Trauma - Typ 1 trifft zu,<br />
wenn ein Kind oder ein Erwachsener einem unerwarteten traumatischen Erlebnis wie<br />
einer Trennung <strong>von</strong> den Eltern, einem Unfall, Gewalterfahrungen oder einer<br />
Naturkatastrophe ausgesetzt wird. Der Trauma - Typ 2 bezeichnet ein wiederholtes<br />
Erleben extrem negativer und belastender Erfahrungen wie sexuelle Misshandlungen,<br />
Gewalterfahrungen oder Vernachlässigung.<br />
Mit Bezug auf diese Klassifikation bezeichnet HOKSBERGEN beide Trauma – Typen<br />
als zutreffend für rumänische Waisenkinder, da diese nicht nur die Trennung <strong>von</strong> ihren<br />
Eltern erlebt haben, sondern häufig auch unter Vernachlässigung und fehlenden<br />
Bezugspersonen litten.<br />
In zahlreichen Studien wurde der Zusammenhang zwischen dem Erleben eines Traumas<br />
und dem <strong>von</strong> vielen Adoptiveltern beobachteten „Problemverhalten“ ihrer Kinder<br />
untersucht (vgl. Federici, 1998; Rutter, 1999, Chugani, 2001; Hoksbergen, 2004).<br />
FEDERICI spricht in diesem Kontext <strong>von</strong> einem „post-institutional-syndrom“ und<br />
schlussfolgert, dass Kinder, die zwei oder drei Jahre in einem Heim verbracht haben,<br />
mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS)<br />
entwickeln werden. Andere Autoren sind bei der Klassifikation <strong>von</strong> Symptomen<br />
vorsichtiger und betonen die Schwierigkeiten beim Stellen einer genauen Diagnose. Es<br />
werden jedoch in den meisten Studien Symptome beschrieben, die denen einer PTBS<br />
ähneln, die aber als Symptome <strong>von</strong> Bindungsstörungen oder gar als autismus-ähnliche<br />
Symptome eingeordnet werden.<br />
61