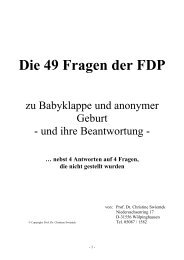Die soziale Konstruktion von Behinderung durch frühkindliche ...
Die soziale Konstruktion von Behinderung durch frühkindliche ...
Die soziale Konstruktion von Behinderung durch frühkindliche ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
desto eher die Gefahr unreflektierter - auf Techniken orientierte, Kompetenzen<br />
negierende und Anerkennung außer Kraft setzende – trivialisierender<br />
Behandlungsverfahren“ (vgl. Turnbull, 1985, zit. nach Jantzen, 2002a, S. 8). Neben den<br />
Gewalterfahrungen, die JANTZEN als den „verborgenen Kern geistiger <strong>Behinderung</strong>“<br />
bezeichnet (2002b), sind auch die Transaktionen zwischen geistig behinderten Kindern<br />
und ihren Bezugspersonen häufiger gefährdet oder gar gestört. <strong>Die</strong>tmut NIEDECKEN<br />
schreibt vom ‚Geistigbehindertwerden’, <strong>von</strong> Fantasmen und vom verlorenen<br />
Menschlichen.<br />
7.2 ‚Institution Geistigbehindertsein’ 21<br />
NIEDECKEN benennt in Bezug auf die ‚Institution Geistigbehindertsein’ drei<br />
Merkmale, die diese organisieren. Zum einen geht sie da<strong>von</strong> aus, dass kein Mensch mit<br />
einer geistigen <strong>Behinderung</strong> geboren werden kann. Wie auch in dieser Arbeit<br />
beschrieben, ist das Neugeborene zu keinerlei geistiger Differenzierung in der Lage,<br />
sondern entwickelt sein Psychisches in der Auseinandersetzung mit seiner Umwelt.<br />
Innerhalb dieser Transaktionen werden dem Kind die Einstellungen und Haltungen<br />
seines Umfeldes ihm gegenüber vermittelt.<br />
<strong>Die</strong> Diagnose, die gesellschaftlichen Fantasmen vom ‚Geistigbehindertsein’ sowie die<br />
institutionalisierte Techniken der Rehabilitation und Integration bezeichnet die Autorin<br />
als Organisatoren der Institution ‚Geistigbehindertsein’, da sie mit ihrer Aussprache<br />
oder dem bloßen Verdacht Einfluss auf die Beziehung zwischen der Mutter und ihrem<br />
behinderten Kind nehmen. <strong>Die</strong> Behandlungstechnologien dienen schließlich dem Ziel,<br />
die zu Therapierenden noch weiter in jene Ecke zu drängen, in die wir sie aufgrund der<br />
Diagnose und gesellschaftlicher Vorstellungen bereits abgeschoben haben (vgl.<br />
Niedecken, 2003, S. 25f.).<br />
NIEDECKEN stellt die Angst in den Mittelpunkt ihrer Betrachtungen: Angst, sich mit<br />
„diesen Menschen“ einzulassen und aufgrund dieser Angst immer wieder ihre<br />
Andersartigkeit zu betonen, sich abzugrenzen und sie einer Therapie zu unterwerfen, die<br />
sie ein Stückchen gleicher machen könnte. Angst vor dem Eingeständnis <strong>von</strong><br />
„Tötungsfantasien“ oder „Wegmachwünschen“, die sich Eltern nicht eingestehen<br />
können. Angst vor der eigenen Schuld, vielleicht in der Schwangerschaft doch etwas<br />
falsch gemacht und damit eine <strong>Behinderung</strong> provoziert zu haben. Angst vor der<br />
21 „Institutionen sind zu festen Regelsystemen verdinglichte hierarchische Interaktionsstrukturen, die<br />
nicht mehr in ihrer interaktiven Bedeutung gesehen werden, sich vielmehr naturhaft-unabänderlich<br />
darstellen“ (Niedecken mit Bezug auf Mannoni, 2003, S. 17f).<br />
80