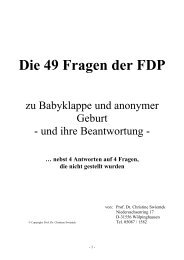Die soziale Konstruktion von Behinderung durch frühkindliche ...
Die soziale Konstruktion von Behinderung durch frühkindliche ...
Die soziale Konstruktion von Behinderung durch frühkindliche ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Reflexionen im Sinne der Beschreibungen oder Darstellungen <strong>von</strong> Handlungen und<br />
Situationen werden als kognitive Kompetenzen aufgefasst, die sich in diagnostische und<br />
pädagogische Kompetenzen unterteilen lassen. Mit diagnostischen Kompetenzen sind<br />
die Beobachtungen der Eltern <strong>von</strong> Verhaltensänderungen ihrer Kinder, die<br />
Rekonstruktion ihrer bisherigen Entwicklung und das Wahrnehmen der Interessen,<br />
Bedürfnisse und Motive der Kinder gemeint. Unter pädagogischen Kompetenzen<br />
versteht die Autorin u.a. die Kommunikation mit dem Kind, das Erproben <strong>von</strong><br />
Begegnungsmöglichkeiten zwischen Eltern und Kind, die Orientierung des Kindes im<br />
Tagesablauf, das Favorisieren oder Ablehnen bestimmter pädagogischer oder<br />
therapeutischer Methoden und Techniken.<br />
Auf der Ebene der <strong>soziale</strong>n Kompetenzen, können die Eltern Bindungen und<br />
Beziehungen reflektieren sowie ihr <strong>soziale</strong>n Netz darstellen. Familiäre und<br />
außerfamiliäre Bindungen werden <strong>von</strong> den Eltern im Hinblick auf ihre eigene Position<br />
innerhalb der Beziehungsgeflechte wahrgenommen, mögliche Veränderungen aufgrund<br />
der <strong>Behinderung</strong> ihrer Kinder analysiert. Zugleich nehmen die Eltern<br />
Unterstützungsangebote wahr oder bieten ihr zum Teil sehr spezielles und im Laufe der<br />
Zeit erworbenes Fachwissen anderen Betroffenen an.<br />
<strong>Die</strong> vielfältigen <strong>von</strong> ZIEMEN herausgefilterten Kompetenzen der Eltern behinderter<br />
Kinder können erst <strong>durch</strong> die Anerkennung dieser <strong>durch</strong> Ärzte, Therapeuten, Pädagogen<br />
wie auch <strong>durch</strong> das gesellschaftlichen Umfeld als solche erscheinen. <strong>Die</strong> Familien<br />
können erst <strong>von</strong> ihren Positionen am Rand der Felder in die Mitte rücken, wenn ihnen<br />
das jeweilige Kapital zuerkannt wird. Eltern könnnen erst dann den „Pol der<br />
Ohnmacht“ verlassen, wenn ihre Kompetenzen <strong>von</strong> der sogenannten Fachwelt<br />
anerkannt und sie als gleichwertige Dialogpartner wahrgenommen werden. Zum<br />
Abschluss ihrer Untersuchungen fordert ZIEMEN (2003) eine bedingungslose<br />
Anerkennung der Eltern als Voraussetzung für eine Kooperation, realisiert im Dialog, in<br />
der Kommunikation und der gemeinsamen Tätigkeit .<br />
Hinsichtlich der in dieser Arbeit dargestellten Ansätze zu den Voraussetzungen <strong>von</strong><br />
Entwicklung, der Bedeutung der Emotionen und den Folgen <strong>von</strong> Isolation und<br />
Marginalisierung kann dem strikten Vermeiden derartiger <strong>soziale</strong>r Regelverletzungen<br />
nur zugestimmt werden.<br />
Isolation und Einschränkungen der Teilhabe führen zu Be-Hinderungen, nicht nur für<br />
den Einzelnen, sondern auch für dessen Umfeld. Durch gesellschaftliche Ausgrenzung<br />
der Betroffenen und ihrer Familien, <strong>durch</strong> deutliche Verschiebungen im Feld der Macht<br />
84