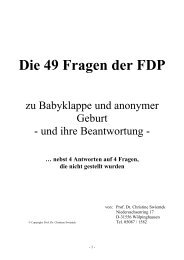Die soziale Konstruktion von Behinderung durch frühkindliche ...
Die soziale Konstruktion von Behinderung durch frühkindliche ...
Die soziale Konstruktion von Behinderung durch frühkindliche ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
O´CONNOR und RUTTER fanden heraus, indem sie 111 Kinder, die in Institutionen<br />
aufgewachsen waren und dann nach Großbritannien adoptiert wurden, mit einer Gruppe<br />
<strong>von</strong> 52 Adoptivkindern verglichen, die keine frühen Deprivationserfahrungen gemacht<br />
hatten, dass Bindungsstörungen mit der Dauer der Vernachlässigung positiv korrelieren<br />
(vgl. O´Connor, Bredenkamp, Rutter, 1999). <strong>Die</strong> verfügbaren Ergebnisse zum<br />
Verhalten bei Bindungsstörungen deuten darauf hin, dass das Fehlen einer dauerhaften<br />
responsiven Bezugsperson oder der Möglichkeit eine selektive Bindung einzugehen, die<br />
Grundlagen für die Entwicklung einer solchen Störung sind (ebda, S.24). Mit Bezug auf<br />
BOWLBY wird beschrieben, welchen Stellenwert dieser Aufbau einer selektiven<br />
Bindungsbeziehung hat. So wurden auch bei der Vergleichsgruppe, die keine<br />
schwerwiegende Vernachlässigung erfahren hatte, jedoch ebenfalls keine konsistente<br />
Bindung zu einer Person aufbauen konnte, jene Auffälligkeiten im Verhalten<br />
festgestellt. Nahrungsmangel und Deprivation per se scheinen somit keine primär<br />
kausale Rolle zu spielen, so die Autoren. Ein weiteres Ergebnis dieser und auch der<br />
folgenden Untersuchungen war, dass die Merkmale der Verhaltensauffälligkeiten mit<br />
der Zeit deutlich abnahmen, die Kinder zeigten, je länger sie in der Adoptivfamilie<br />
lebten, linear weniger Probleme. Es wird vermutet, dass diese Verbesserungen nicht nur<br />
auf eine sensible Bezugsperson in der Familie zurückgehen, sondern auch in der<br />
Abwesenheit anderer Deprivationsformen begründet liegen (ebda. S. 23).<br />
RUTTER und seine Kollegen kamen in ihrer Studie zu quasi-autistischen Mustern bei<br />
Kindern mit frühen Deprivationserfahrungen zu ähnlichen Ergebnissen (vgl. Rutter et<br />
al, 1999). Bei beachtlichen 6% einer Gruppe <strong>von</strong> 111 rumänischen Waisenkindern<br />
wurden autismusähnliche Merkmale gefunden, weitere 6% der Kinder zeigten<br />
schwächere und meist isolierte autistische Merkmale 13 (ebda. S. 537). RUTTER<br />
bezeichnet diese Zahl, verglichen mit Zahlen aus generellen Bevölkerungsschichten, als<br />
zu hoch, als dass sie mit einem zufälligen Wert abgetan werden könnte. <strong>Die</strong><br />
Wissenschaftler versuchten das Syndrom, welches diese Kinder zeigten, <strong>von</strong><br />
<strong>frühkindliche</strong>m Autismus zu unterscheiden. Sie fragten weiterhin nach den Gründen für<br />
die quasi-autistischen Merkmale. Alle Kinder mit diesen mehr oder weniger schweren<br />
Merkmalsausprägungen unterschieden sich <strong>von</strong> den anderen rumänischen<br />
13 <strong>Die</strong> Autoren beziehen sich auf „Schlüsselmerkmale derzeit vorherrschender Autismuskonzepte“ ohne<br />
diese näher zu benennen. Sie beschreiben Schwierigkeiten innerhalb <strong>soziale</strong>r Beziehungen und in der<br />
Kommunikation, Probleme beim Eingehen selektiver Freundschaften und in der <strong>soziale</strong>n Reziprozität.<br />
Mangelnde Empathie und das Vermeiden <strong>von</strong> Blickkontakt sowie die Beobachtung ausgeprägter<br />
persönlicher Vorlieben und „Ticks“ bezeichnen RUTTER und Kollegen ebenfalls als autistische oder<br />
autismusähnliche Merkmale (vgl. Rutter et al. 1999, S.539).<br />
63