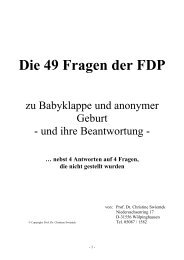Die soziale Konstruktion von Behinderung durch frühkindliche ...
Die soziale Konstruktion von Behinderung durch frühkindliche ...
Die soziale Konstruktion von Behinderung durch frühkindliche ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
und Erfahrungen. Der Mensch der auf Austausch, Dialog und Wechselbeziehung zu<br />
anderen angewiesen ist, wird <strong>durch</strong> ein Nichterfüllen dieser Grundbedürfnisse in<br />
hochgradige Isolation gestürzt. Es fehlt an lebensnotwendigen Informationen <strong>von</strong><br />
außen, die das System integrieren und darüber Stabilität erlangen könnte.<br />
6.1.2 Isolation als zentraler Begriff<br />
Wie bereits unter 6.1 beschrieben, kennzeichnen sowohl innere als auch äußere<br />
isolierende Bedingungen ein verändertes Verhältnis zwischen dem Individuum und<br />
seiner Umwelt. <strong>Die</strong>se veränderte Beziehung nimmt Einfluss auf das Erleben der<br />
Wirklichkeit des Einzelnen und damit auf die Einheit seiner psychischen Prozesse. Der<br />
Aufbau des Psychischen ist abhängig <strong>von</strong> der <strong>soziale</strong>n Gesamtsituation in dem jeweils<br />
konkreten Lebensumfeld. Isolation, ob <strong>durch</strong> äußere Umstände der Institutionalisierung<br />
erzeugt oder <strong>durch</strong> eine Schädigung des Gehirns begründet, versetzt den Menschen in<br />
eine Situation, in welcher er sein Leben unter erschwerten Bedingungen organisieren<br />
muss. Anhand zahlreicher Beispiele lässt sich zeigen, dass <strong>Behinderung</strong> unter<br />
Bedingungen der Isolation konstruiert wird. Psychische Auffälligkeiten oder sekundäre<br />
und tertiäre Kompensationsmuster wie VYGOTSKIJ sie bezeichnet (vgl. Vygotskij,<br />
2001b), die häufig im Zusammenhang mit schwerer geistiger <strong>Behinderung</strong> gesehen<br />
werden, resultieren meist aus isolierenden Lebensverhältnissen.<br />
Anhand einer ethnomethodologischen Studie beschreibt David GOODE (1994, vgl.<br />
Rusch 2001) die Auswirkungen isolierender Bedingungen auf Kinder mit „Rubella-<br />
Syndrom“. Er zeigt, dass sich schwere geistige <strong>Behinderung</strong> entsprechend des <strong>soziale</strong>n<br />
Umfeldes der Mädchen auf bestimmte Art und Weise sozial konstruiert. Deutliche<br />
Unterschiede in der Betrachtung und Einschätzung der Fähigkeiten der betreffenden<br />
Mädchen lassen sich, so GOODE, aus ihrem jeweiligen Lebensumfeld heraus erklären.<br />
<strong>Die</strong> Beurteilung der <strong>Behinderung</strong> und die daraus resultierenden Möglichkeiten<br />
beschreibt er als abhängig <strong>von</strong> den jeweiligen Lebenszusammenhängen, je nachdem ob<br />
die Mädchen in einer Großeinrichtung mit medizinischem oder pädagogisch geschultem<br />
Betreuungspersonal interagieren oder ob die Kommunikation innerhalb der Familie auf<br />
der engen Bindung der Familienmitglieder beruht.<br />
<strong>Behinderung</strong> als ein Resultat isolierender Bedingungen betrachten zu können, setzt<br />
voraus, dass der Mensch in seiner Ganzheit betrachtet wird, in der Gesamtheit der bio-,<br />
psycho- <strong>soziale</strong>n Einheit und der Verhältnisse zwischen ihnen. VYGOTSKIJ betont<br />
bereits 1931 das Wechselverhältnis <strong>soziale</strong>r und biologischer Gesetzmäßigkeiten in der<br />
59