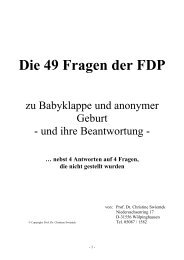Die soziale Konstruktion von Behinderung durch frühkindliche ...
Die soziale Konstruktion von Behinderung durch frühkindliche ...
Die soziale Konstruktion von Behinderung durch frühkindliche ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
spiegelt die Übererregung die ständige Erwartung der Gefahr wider, Intrusion die<br />
unauslöschliche Prägung <strong>durch</strong> den traumatischen Augenblick und Konstriktion die<br />
Erstarrung als Reaktion auf die Niederlage (vgl. Hermann, 2003, S. 56).<br />
6.4.1 Symptome posttraumatischer Störungen<br />
Übererregung<br />
Der Selbstschutz eines Menschen scheint sich nach einem traumatischen Ereignis in<br />
einem ständigen Alarmzustand zu befinden (ebda.). Als könnte die Gefahr jeden<br />
Augenblick erneut über ihn hereinbrechen, hält der physiologische Erregungszustand<br />
unvermindert an. In Studien wurde nachgewiesen, dass Betroffene an allgemeinen<br />
Angstsymptomen leiden, die mit spezifischen Befürchtungen verknüpft sind und dass<br />
ihr Grundniveau einem Zustand erhöhter Erregung entspricht. Schreckhafte Reaktionen<br />
auf unerwartete und vor allem spezifische Reize, die mit dem traumatischen Ereignis in<br />
irgendeiner Form verbunden sind, können die Folge sein. <strong>Die</strong> erhöhte Erregung hält<br />
sowohl im Wach- als auch im Schlafzustand an, so dass häufig <strong>von</strong> massiven<br />
Schlafstörungen berichtet wird. HERMANN vermutet, dass Traumata das menschliche<br />
Nervensystem tief greifend verändern (ebda. S. 58).<br />
VAN DER KOLK betont den Verlust der Funktion der Emotionen als Signale, da<br />
„chronische Erregung und die daraus resultierende Unfähigkeit, autonome Reaktionen<br />
auf interne und externe Stimuli zu regulieren, (…) die Fähigkeit“ beeinträchtigt,<br />
„Emotionen als Signale zu nutzen“ (2000, S. 199). Er beschreibt das limbische System<br />
als den Teil des Zentralen Nervensystems (ZNS), der die Emotionen und das für die<br />
Selbsterhaltung und das Überleben der Art benötigte Verhalten aufrecht erhält und<br />
steuert. Neurophysiologische Veränderungen in folge traumatischer Erfahrungen oder<br />
dissoziative Störungen sind größtenteils mit den Strukturen des limbischen Systems<br />
verbunden. <strong>Die</strong>se Strukturen werden als neuronales Substrat der Emotionen beschrieben<br />
und sind als solche <strong>von</strong> großer Bedeutung für die Bildung des Gedächtnisses.<br />
Sowohl während des Wach- als auch während des Schlafzustands werden kontinuierlich<br />
Signale <strong>von</strong> den Sinnesorganen zum Thalamus übertragen und <strong>von</strong> dort zum Kortex<br />
weitergeleitet, wo sie das Denken beeinflussen, über die Stammganglien, wo sie die<br />
Bewegung beeinflussen, hin zum limbischen System, wo sie Einfluss auf die<br />
Erinnerungstätigkeit und die Emotionen haben (S. 212). Der größte Teil der<br />
und DSM-IV) eine Sonderstellung, da sie nicht rein deskriptiv, sondern äthiopathogenetisch konzipiert<br />
ist. Das heißt, anders als bei anderen psychischen Störungen, wird unterstellt, dass es eine spezifische<br />
Ursache der PTSD gibt, nämlich ein vorhergegangenes Trauma (vgl. Hermann, 2003, S. 161ff).<br />
71