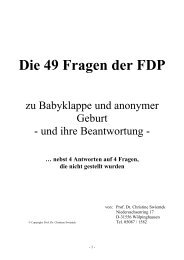Die soziale Konstruktion von Behinderung durch frühkindliche ...
Die soziale Konstruktion von Behinderung durch frühkindliche ...
Die soziale Konstruktion von Behinderung durch frühkindliche ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
häufig zur <strong>soziale</strong>n Regelverletzung, also zu einer Verletzung <strong>von</strong> Grundsätzen, „die auf<br />
gegenseitiger Achtung, dialogischer Bereitschaft, Anerkennung, Bereitschaft zur<br />
Unterstützung u.v.a. beruhen.“ (2003, S. 30) Als Beispiele sind extrem verkürzte<br />
Diagnosemitteilungen ohne eine Beratung, das völlige Versäumen einer Aufklärung<br />
sowie eine Konfrontation mit unterschiedlichen und zum Teil falschen Diagnosen zu<br />
nennen. Darüber hinaus nennen die Eltern <strong>soziale</strong> Regelverletzungen seitens der<br />
Schulbehörde, Pädagogen und Therapeuten. So wird den Eltern die freie Wahl der<br />
Schule für ihre Kinder verweigert, das Unterstützungsangebot der Eltern zur<br />
Qualitätssicherung des integrativen Unterrichts abgelehnt oder die Integration eines<br />
schwer beeinträchtigten Kindes verunmöglicht (ebda. S. 32). Derartige Situationen<br />
können die Eltern in den entsprechenden <strong>soziale</strong>n Feldern schnell an den „Pol der<br />
Ohnmacht“ versetzen und führen zu Verletzungen, Demütigungen, Kränkungen sowie<br />
zu Sinnverlust und negativ veränderten <strong>soziale</strong>n Situationen (ebda. S. 33).<br />
ZIEMEN beschreibt die daraus entstehende Situation für die Eltern als widersprüchlich.<br />
Meist ergibt sich ein grundlegender Widerspruch zwischen dem Wert, den die Eltern<br />
sich selbst gegenüber in der Elternrolle erleben und der Abwertung, die sie <strong>von</strong> sog.<br />
Fachleuten oder der Gesellschaft bezüglich ihrer Position und der ihres Kindes zu<br />
spüren bekommen. Widersprüche entstehen ebenfalls hinsichtlich herkömmlicher<br />
Wertvorstellungen und Maßstäbe und dem individuellen Erleben des Kindes, was sich<br />
nicht selten in Form <strong>von</strong> Nicht-Übereinstimmungen der Prognosen und Diagnosen mit<br />
der tatsächlichen Entwicklung des Kindes ausdrückt. Dabei werden dem Kind nicht<br />
selten seitens des diagnostischen Fachpersonals jegliche Entwicklungsmöglichkeiten<br />
abgesprochen, was dem Erleben der Eltern konträr gegenübersteht (ebda. S. 33f). 22<br />
ZIEMEN versteht die Kompetenzen der Eltern als Reflexionen auf deren jeweilige<br />
Situation. Sie unterscheidet zwischen unterschiedlichen Reflexionsebenen, wobei alle<br />
<strong>von</strong> den Eltern angebotenen Ebenen als Kompetenzen anerkannt werden (vgl. ebda.<br />
2002, S. 120).<br />
<strong>Die</strong> Ebene der emotionalen Kompetenz lässt sich mit elterlichen Formulierungen über<br />
und dem Bewusstwerden <strong>von</strong> Wünschen, Zweifeln, Ängsten und Veränderungen der<br />
eigenen Person oder des Umfeldes beschreiben. <strong>Die</strong> Eltern reflektieren ihre Gefühle,<br />
Emotionen und Motive hinsichtlich ihrer Kinder, deren Beeinträchtigung und ihrer<br />
gemeinsamen Situation.<br />
22 vgl. hierzu auch die Ausführungen <strong>von</strong> Niedecken, die in einer derartigen Prognose die Schlüsselrolle<br />
für die <strong>Konstruktion</strong> einer geistigen <strong>Behinderung</strong> sieht, da sie das Verhältnis zwischen dem Kind und<br />
seinen Bezugspersonen nachhaltig verändern kann (Niedecken, 1993).<br />
83