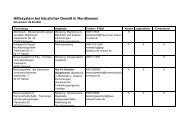Landesentscheid 2009 33. Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"
Landesentscheid 2009 33. Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"
Landesentscheid 2009 33. Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Die Entwicklung ländlicher Räume in Hessen steht heute<br />
vor neuen mehrdimensionalen Herausforderungen. Angesichts<br />
der gravierenden regionalen Unterschiede sind<br />
differenzierte Lösungen gefragt. Das regionalpolitische<br />
Ziel der hessischen Landesregierung heißt deshalb<br />
„Stärkung der regionalen <strong>Wettbewerb</strong>sfähigkeit“ durch<br />
dynamische Entwicklungsprozesse.<br />
Der demografische Wandel <strong>hat</strong> die Dörfer längst erreicht.<br />
Für viele Vereine und Einrichtungen im <strong>Dorf</strong> geht<br />
es um das nackte Überleben. Neben vielen anderen Aspekten<br />
gewinnt die Leerstandsproblematik zunehmend<br />
an Bedeutung. Wenn sich die Leerstände ausbreiten, so<br />
rückt ein absehbares Ende des dörflichen Lebens näher.<br />
Besonders in stark schrumpfenden ländlichen Siedlungsbereichen<br />
ist die ökonomische Tragfähigkeit von<br />
infrastrukturellen Grundausstattungen gefährdet. Die<br />
Infrastrukturkosten je angeschlossenen Haushalt steigen<br />
an. Durch den Bevölkerungsrückgang erhöht sich die<br />
kommunale Pro-Kopf-Verschuldung und engt die Handlungsspielräume<br />
vor Ort weiter ein.<br />
Beispielhaft für den Strukturwandel sei hier auch die<br />
zunehmend fehlende Infrastruktur genannt. Vielerorts<br />
hinterlässt die größte Lücke das nicht mehr existierende<br />
<strong>Dorf</strong>gasthaus – nicht nur für die gastronomische Versorgung,<br />
sondern als zwangloser Anlaufpunkt und Informationsquelle<br />
für Gäste und <strong>Dorf</strong>bewohner<br />
insbesondere außerhalb organisierter Gruppen und<br />
Vereine.<br />
Diese Entwicklungen, vor allem der Bevölkerungsrückgang,<br />
erfordern die Anpassung der Infrastrukturen hinsichtlich<br />
des Nachhaltigkeitsaspektes unter der Prämisse<br />
„Mehr <strong>Dorf</strong> für weniger Bürger“. Hierzu gehören insbesondere<br />
innovative Lösungen zur Sicherung und<br />
Verbesserung der Erreichbarkeit von Einrichtungen der<br />
Grundversorgung sowie deren Umstrukturierung unter<br />
dem Aspekt einer effizienteren Nutzung. So können<br />
z. B. auch Rückbaumaßnahmen in bestimmten Fällen ein<br />
sinnvoller Lösungsansatz sein.<br />
Dies soll im Rahmen der aktuellen Förderprogramme,<br />
durch Verbesserung der Wohnqualität in den Ortskernen<br />
der Dörfer, durch Steigerung der allgemeinen<br />
Lebensqualität, durch Bewahrung des kulturellen Erbes<br />
und der regionalen Identitäten sowie durch Wertschöpfung<br />
aus der Entwicklung wirtschaftlicher Kompetenz<br />
und des Landtourismus erreicht werden. Durch diese<br />
Dieter Posch<br />
Förderprogramme sollen sich wettbewerbs-, wertschöpfungs-<br />
und beschäftigungswirksame Impulse im Sinne<br />
einer selbstragenden Entwicklung besser entfalten können.<br />
Darüber hinaus ist eine weitere wichtige Aufgabe im<br />
ländlichen Raum die Förderung der Kompetenzentwicklung<br />
z.B. von leitenden Akteuren der Regionalforen, von<br />
ehrenamtlichen Akteuren auf der örtlichen und regionalen<br />
Ebene sowie für Existenzgründer, durch fachliche<br />
Fortbildung, Coaching, Prozessmanagement und<br />
Controlling, um den demografischen Wandel strukturierend<br />
zu begleiten sowie regionsspezifische Entwicklungschancen<br />
zu erkennen und daraus Projekte<br />
anzustoßen. Neue demografisch notwendige Anpassungsstrategien<br />
und die Überwindung interkommunaler<br />
Konkurrenzen (Kirchturmdenken) sind dabei unerlässlich.<br />
Sie sind die Voraussetzung dafür, dass eine nachhaltige<br />
Innenentwicklung der Städte und Gemeinden stattfinden<br />
kann. Dazu gehören verschiedene regionale Vernetzungsstrategien<br />
wie z. B. kommunale Kooperationen,<br />
interkommunale Entwicklungskonzepte und landesweite<br />
Pilotprojekte, wie z.B. „Vitale Orte 2020“.<br />
Das Entwicklungsziel lautet dabei „Innenentwicklung<br />
geht vor Außenentwicklung“, da die Nutzung der<br />
Bausubstanz in den Kerngebieten vieler Dörfer nicht<br />
mehr nachhaltig gesichert ist. Um eine nachhaltige<br />
Innenentwicklung zu ermöglichen, sollte eine kommunale<br />
Gesamtstrategie für Investitionen in die Kernbereiche<br />
der Kommunen entwickelt und der Verzicht auf<br />
weitere Baulandausweisungen festgeschrieben werden.<br />
In der Konsequenz lassen sich dadurch sowohl ein weiterer<br />
Flächenverbrauch in den Ortsrandlagen als auch<br />
weitere Erschließungskosten für die Kommune durch<br />
Straßenbau sowie Ver- und Entsorgung reduzieren und<br />
in vielen Fällen können die bestehenden Systeme auch<br />
wieder ausgelastet werden.<br />
Die Förderung kann heute auch über die Förderschwerpunkte<br />
hinausgehend in anderen Ortsteilen zur Umsetzung<br />
eines ortsübergreifenden Innenentwicklungskonzepte<br />
für Investitionsmanagement und punktuelle<br />
Maßnahmen zur Innenentwicklung der Ortskerne eingesetzt<br />
werden. Voraussetzung dafür ist, dass die Orte und<br />
Maßnahmen im Rahmen der kommunalen Entwicklungsstrategie<br />
mit dem Förderschwerpunkt in einen<br />
überörtlichen konzeptionellen Zusammenhang gestellt<br />
und in Dimension und Wirkung beschrieben sind.<br />
166 <strong>33.</strong> <strong>Wettbewerb</strong> „<strong>Unser</strong> <strong>Dorf</strong> <strong>hat</strong> Zukunft”