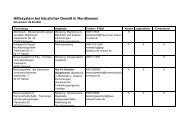Landesentscheid 2009 33. Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"
Landesentscheid 2009 33. Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"
Landesentscheid 2009 33. Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Ulf Häbel<br />
Das Traditionsdreieck der Alt-Dörfler ist ihnen fremd, ja<br />
geradezu suspekt. Sie wollen sich auch nicht in die traditionelle<br />
<strong>Dorf</strong>gemeinschaft (Gesangverein, Feuerwehr,<br />
Schützenverein) einbringen. Für die Alt-Dörfler ist dieses<br />
starke persönliche Interesse der Neu-Dörfler bei<br />
gleichzeitig fehlender Identitätsabsicht mit dem alten<br />
<strong>Dorf</strong> befremdlich, fast beleidigend.<br />
3. Die emanzipierten Dörfler<br />
Eine dritte Gruppe, die in den letzten drei Jahrzehnten<br />
in Dörfern von sich reden machten, kann man als emanzipierte<br />
Dörfler bezeichnen. Es handelt sich oft um jüngere<br />
Menschen – besonders Frauen – die eine neue<br />
Ländlichkeit und Lust am <strong>Dorf</strong> mitbringen. Sie ziehen<br />
ähnlich wie die Neu-Dörfler aus irgendeinem, oft individuellen<br />
Grund ins <strong>Dorf</strong>. Oft sind es auch Menschen, die<br />
nach längerer Abwesenheit (z. B. Ausbildung, Beruf) in<br />
ihr Herkunftsdorf zurückkehren. Sie sind in der Regel<br />
nicht an der traditionellen, ländlichen Agrarkultur interessiert,<br />
aber am <strong>Dorf</strong> als regionalem Lebensraum. Sie<br />
suchen gemeinsame Handlungsorte im <strong>Dorf</strong>. Sie engagieren<br />
sich in Bürgerinitiativen, die z.B. zur Einrichtung<br />
von Krabbelgruppen für Kleinkinder führen. Sie bringen<br />
Ideen zur Einrichtung eines Waldkindergartens ein oder<br />
unterstützen die Wiedereröffnung von <strong>Dorf</strong>schulen,<br />
Läden oder Selbstvermarktungshöfen. Man könnte sie<br />
als Anhänger einer neuen ländlichen Bewegung bezeichnen.<br />
Ihr Bewegungsdreieck ist zwischen Bürgerinitiativen,<br />
Direktvermarktungsorten und dörflichen<br />
Kunstkneipen zu sehen. Sie haben zwar eine gebrochene<br />
und auf Zeit begrenzte Identität mit dem <strong>Dorf</strong>; ihr<br />
Interesse gilt aber der Gestaltung des gemeinsamen<br />
dörflichen Lebens. In diesem Bewusstsein, dass Treffpunkte,<br />
Kontakte und Kommunikation zwischen den<br />
Menschen sinnvoll und nötig sind, gibt es Berührungspunkte<br />
mit den Alt-Dörflern und gelegentlich Handlungskoalitionen<br />
mit ihnen.<br />
4. Die Rand-Dörfler<br />
Eine vierte Gruppe stellen Randsiedler des <strong>Dorf</strong>es, die<br />
isoliert und am Rand leben. Ob es die entwürdigend bezeichneten<br />
„<strong>Dorf</strong>deppen” sind oder zwangsweise zugewanderte<br />
Aussiedler oder Asylsuchende: Sie leben ohne<br />
innere Zugehörigkeit zum <strong>Dorf</strong>, bleiben meist Randsiedler<br />
und heimatlos. Sie finden ihr Bewegungsdreieck<br />
<strong>33.</strong> <strong>Wettbewerb</strong> „<strong>Unser</strong> <strong>Dorf</strong> <strong>hat</strong> Zukunft”<br />
an Orten kultureller Heimatlosigkeit bzw. in cliquenbestimmten<br />
Nischen: In der Gartenhütte am Ortsrand, in<br />
ihrem eigenen Kultverein (Fanclub) und in auffallendem<br />
Konsumverhalten (Medien, Alkohol). Sie spielen für die<br />
aktive Gestaltung des dörflichen Lebens keine Rolle. Sie<br />
werden, wenn die Anzahl nicht zu groß ist, meist geduldet,<br />
aber kaum ins dörfliche Leben einbezogen. Sie verbindet<br />
eher eine negative Identität mit dem <strong>Dorf</strong>. Wenn<br />
man das dörfliche Leben im Horizont dieser vier „Kulturkreise”<br />
bzw. Verhaltensmuster begreift, wird klar, dass<br />
das <strong>Dorf</strong> ein Lebensraum sozialer Umbrüche und Spannungen<br />
ist.<br />
Eindeutige Orientierungen sind der Vielfalt und Widersprüchlichkeit<br />
gewichen. Auseinandersetzungsfähigkeit<br />
ist angesagt, die auf der Anerkennung der neuen Pluralität<br />
des <strong>Dorf</strong>es basiert. Es geht in einer nachhaltigen<br />
Entwicklung des dörflichen Lebens nicht um die Frage,<br />
welche Gruppierung sich durchsetzt, sondern um die<br />
gegenseitige Vermittlung der Lebensformen und die<br />
Vernetzung der verschiedenen kulturellen Prägungen.<br />
Im Mittelpunkt des dörflichen Lebens steht nicht eine<br />
bestimmte Prägung des Menschen, sondern der<br />
Mensch selbst, in seiner gottebenbildlichen Würde und<br />
mit seinem Recht auf die eigene und im sozialen Kontext<br />
verantwortete Lebensgestaltung. Dieser kulturvermittelnden<br />
Aufgabe sollte sich die Kirche im <strong>Dorf</strong> stellen.<br />
Denn sie ist mit ihrer biblischen Botschaft an den Menschen<br />
gewiesen, dessen Wert nicht in ökonomischer<br />
Nutzbarkeit oder einer spezifischen kulturellen Prägung<br />
liegt, sondern in seiner Gottebenbildlichkeit und Versöhnungsfähigkeit.<br />
Die Kirchengemeinde kann Forum<br />
für den vermittelnden Diskurs sein, da sie sich nicht partikularen<br />
Interessen unterwerfen muss. Pfarrerinnen und<br />
Pfarrer im <strong>Dorf</strong> sollten „Lotsen” zwischen den unterschiedlichen<br />
Kulturen sein, um verständnisverbindend<br />
und vermittelnd zu einer gemeinsamen Kultur der<br />
Menschlichkeit beizutragen.<br />
III. Lasst die Kirche im <strong>Dorf</strong> –<br />
die letzte Instanz für eine Kultur<br />
der versöhnten Gemeinschaft<br />
In einem <strong>Dorf</strong> gab es Streit zwischen zwei Vereinen um<br />
den Termin und die Gestaltung der Kirmes. Als sich<br />
keine Lösung in dem entstandenen Konflikt finden ließ,<br />
gingen ein paar Leute zum Ortspfarrer mit der Bitte:<br />
„Herr Pfarrer, Sie müssen sich da einmischen; die Kirche<br />
171