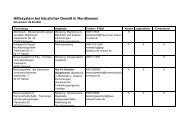Landesentscheid 2009 33. Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"
Landesentscheid 2009 33. Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"
Landesentscheid 2009 33. Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Ulf Häbel<br />
Pfarrer i.R. aus Laubach-Freienseen<br />
Auf dem Land daheim – Die kulturtragende Aufgabe<br />
der Kirche im <strong>Dorf</strong><br />
Berufssoziologische Aspekte aus der Arbeit<br />
eines <strong>Dorf</strong>pfarrers<br />
Vor neunzehn Jahren bin ich mit meiner Familie aufs<br />
Land gezogen. Dort war ich mit einer halben Anstellung<br />
19 Jahre lang <strong>Dorf</strong>pfarrer, betreibe nebenher eine<br />
Selbstversorgerlandwirtschaft und beschäftige mich intensiv<br />
mit der Frage nach dem Leben auf dem Land.<br />
Wenn ich in Synoden oder anderen kirchlichen Gremien<br />
von Landleben oder der Kirche im <strong>Dorf</strong> rede, wird dies<br />
oft mit der Bemerkung “idyllisch” kommentiert. Doch<br />
mich interessiert nicht die vermeintliche Idylle des Lebens<br />
auf dem Land und auch nicht die traditionsorientierte<br />
Positionierung der Kirche im <strong>Dorf</strong>. Mich interessiert<br />
die Frage nach dem Sinn dörflicher Lebensformen und<br />
was die Kirche zur Sinngebung und Lebensdeutung beitragen<br />
kann.<br />
I. „Von Heimat redet hier keiner”<br />
Dörfer waren einmal relativ eigenständige Lebensräume.<br />
Für die Menschen, die dort arbeiteten und lebten, war<br />
das <strong>Dorf</strong> wie ein Organismus, zu dem sich die meisten<br />
innerlich zugehörig fühlten. Man war im <strong>Dorf</strong> daheim,<br />
das war der unmittelbare Lebensraum auf den sich die<br />
Menschen bezogen haben. Die Gemarkung rundherum,<br />
Feld, Wald und Flur, die Kulturlandschaft war die Lebensgrundlage.<br />
In der Land- und Forstwirtschaft mit den<br />
dazugehörenden Handwerkern fanden die meisten<br />
<strong>Dorf</strong>bewohner Arbeit und Brot. Zu dem Lebensraum<br />
<strong>Dorf</strong> gehörten ganz selbstverständlich der Kindergarten<br />
und die Volksschule dazu. Hier lernten die Kinder Sitten<br />
und Traditionen des <strong>Dorf</strong>es kennen und die Lebensformen<br />
und Überzeugungen der Menschen zu verstehen.<br />
Heimatkunde und Weltgeschichte beschrieben den Horizont,<br />
in dem die nachkommenden Generationen sich<br />
im Gefühl der Zusammengehörigkeit mit den Vorfahren<br />
begriffen. Schließlich muss man wissen, woher man<br />
kommt, um zu wissen, wer man ist.<br />
In den letzten 60 Jahren <strong>hat</strong> sich das Leben auf dem<br />
Land grundlegend gewandelt. Die relative Selbständigkeit<br />
ist einer starken Fremdbestimmung gewichen.<br />
<strong>33.</strong> <strong>Wettbewerb</strong> „<strong>Unser</strong> <strong>Dorf</strong> <strong>hat</strong> Zukunft”<br />
Ländliche Räume sind namenloses „Umland” der Metropolen<br />
geworden. Was zur alltäglichen Lebensgestaltung<br />
und Daseinsvorsorge nötig ist, wanderte in kleinere<br />
oder größere Zentren ab, z.B. Ausbildungsplätze und<br />
bezahlte Arbeit, Läden und Arztpraxen, öffentliche Verwaltungen<br />
und Schulen. Die Menschen auf dem Land<br />
haben diese Veränderungen als Verlust ihrer selbstbestimmten<br />
Lebensformen und der ihnen vertrauten Strukturen<br />
erlebt. Sie fühlten sich als „Opfer” zentralistisch<br />
orientierter Veränderungsprozesse. An drei sogenannten<br />
Reformen will ich das deutlich machen.<br />
Mit der Landreform (Flurbereinigung) begann in den<br />
Fünfzigerjahren des letzten Jahrhunderts die Umwandlung<br />
der kleinräumig-bäuerlichen Landwirtschaft zur<br />
heute global orientierten Agrarindustrie. „Wachsen und<br />
Weichen” ist seitdem das Motto. Bis zum heutigen Tag<br />
geben täglich ca. 50 Bauernhöfe in Deutschland wegen<br />
mangelnder Wirtschaftlichkeit auf. 1950 gab es in der<br />
(alten) Bundesrepublik Deutschland ca. 2,5 Millionen<br />
Bauernhöfe; 2008 sind es im vereinigten Deutschland<br />
knapp 500.000.<br />
Durch die Verwaltungsreform in den Sechzigerjahren<br />
verloren die Dörfer ihre politische Selbständigkeit. Aus<br />
verwaltungstechnischen Gründen wurden die Dörfer in<br />
Städte oder Großgemeinden eingegliedert. Lange Antragswege<br />
zu Behörden und oft von örtlicher Sachkenntnis<br />
ungetrübte Entscheidungen werden von den<br />
Bürgern beklagt. Der Ortsbeirat eines <strong>Dorf</strong>es darf sich<br />
169