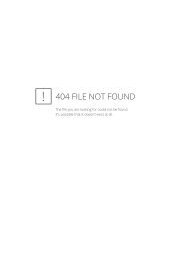zur Rezension - Iudicium Verlag GmbH
zur Rezension - Iudicium Verlag GmbH
zur Rezension - Iudicium Verlag GmbH
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
202<br />
lingsgasse bleibt die Welt der Großstadt<br />
explizit ausgeschlossen, bleibt jedoch im<br />
Topos der »großen Stadt« als einer unsichtbaren<br />
negativen Macht, vor der der<br />
Erzähler den Rückzug an einen sicheren<br />
Ort gesucht hat, stets präsent.<br />
Zeigt Berlin bis <strong>zur</strong> Mitte des 19. Jahrhunderts<br />
(im Gegensatz zu London oder<br />
Paris) eher provinzielle Züge, die sich<br />
auch in der Wahl der literarischen Darstellungsperspektiven<br />
deutlich widerspiegeln,<br />
so beginnt mit der Gründung<br />
des Deutschen Reiches 1871 »die explosionsartige<br />
Entwicklung Berlins <strong>zur</strong> politisch-kulturellen<br />
und wirtschaftlich-industriellen<br />
Metropole« (137). Dieses Berlin<br />
der Gründerzeit bildet den Schauplatz<br />
einer Reihe von Romanen Theodor Fontanes<br />
(u. a. L’Adultera, Irrungen, Wirrungen,<br />
Frau Jenny Treibel). Dargestellt aus<br />
der distanzierten Perspektive eines auktorialen<br />
Erzählers, finden sich in ihnen<br />
eine Vielzahl realistischer Detailbeschreibungen<br />
der geographischen und sozialen<br />
Topographie Berlins als einer »wachsende[n],<br />
keinesfalls jedoch […] unübersichtliche[n]<br />
oder metropolenhafte[n]<br />
Großstadt« (148).<br />
In den knapp 30 Jahren von der Reichsgründung<br />
bis zum Ende des 19. Jahrhunderts<br />
macht Berlin in einem rasanten und<br />
oft unkontrollierten Wachstumsprozeß<br />
die Entwicklung hin zu einer Metropole<br />
durch, die sich mit anderen europäischen<br />
Großstädten messen kann: Der »Moloch<br />
Großstadt« als literarisches Sujet ist geboren<br />
und fordert in der Lyrik wie in der<br />
Erzählliteratur neue Darstellungsformen<br />
heraus. Erst jetzt kann man im Zusammenhang<br />
der Berlin-Literatur von einer<br />
Großstadtliteratur im eigentlichen Sinne<br />
sprechen. »Berlin als Großstadt: Dynamisierungen<br />
und Modernisierungen der<br />
literarischen Wahrnehmung und Beschreibung«<br />
nennt Kiesler dementsprechend<br />
das Kapitel 4.3 seiner Untersuchung.<br />
So wird bereits bei den frühnatu-<br />
ralistischen Autoren, wie Kiesler an Julius<br />
Harts Gedicht Auf der Fahrt nach<br />
Berlin (1885) aufzeigen kann, »das traditionelle<br />
Ruhepunktpanorama […] von<br />
einer dynamisierten Wahrnehmungsform<br />
abgelöst« (206). Nach einer Zeit der<br />
Abkehr von der Großstadt (nicht zuletzt<br />
unter dem Einfluß von Nietzsches kulturund<br />
großstadtkritischen Schriften) setzt<br />
mit den jungen Autoren des frühen<br />
Expressionismus, deren Zentrum Berlin<br />
ist, um 1910 eine weitere Phase der<br />
Großstadtlyrik ein, in deren Mittelpunkt<br />
weniger »die Großstadt an sich« als »die<br />
literarische Imagination der Großstadt«<br />
steht. Wie eine mimetisch verfahrende<br />
Großstadtlyrik hier von einer Darstellungsform<br />
abgelöst wird, die einen mit<br />
mythisch verfremdeten Bildern erfüllten,<br />
atemporalen, imaginativen Raum konstituiert,<br />
in dem keine eindeutige Origo des<br />
Sprechens auszumachen ist, zeigt Kiesler<br />
am Beispiel von Georg Heyms Gedicht<br />
Der Gott der Stadt (1910) auf.<br />
In einer Untersuchung <strong>zur</strong> literarischen<br />
Darstellung Berlins darf selbstverständlich<br />
der Roman nicht fehlen, der – nicht<br />
zuletzt aufgrund der Tatsache, daß die<br />
Stadt selbst hier zum Protagonisten wird<br />
– als der Berlin- und Großstadtroman<br />
schlechthin gilt: Alfred Döblins 1929 veröffentlichter<br />
Roman Berlin Alexanderplatz.<br />
Über das Verfahren der gegenseitigen<br />
Erhellung von linguistischer und literaturwissenschaftlicher<br />
Analyse ausgewählter<br />
Passagen des Romans gelingt es<br />
Kiesler, sowohl die multiplen Erzählperspektiven<br />
genau zu rekonstruieren, als<br />
diese auch in ihrem funktionalen Zusammenhang<br />
der Darstellung der »Ungleichzeitigkeiten<br />
und Divergenzen« (181) des<br />
Berlins der Weimarer Republik näher zu<br />
beleuchten. Ganz andere literarische Verfahren<br />
der Erfassung der Großstadt als<br />
Döblin wählt Franz Hessel in seinem<br />
ebenfalls im Jahr 1929 erschienenen Prosatext<br />
Ein Flaneur in Berlin. Das in der