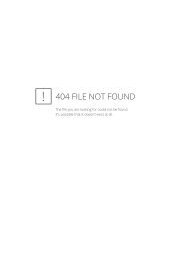zur Rezension - Iudicium Verlag GmbH
zur Rezension - Iudicium Verlag GmbH
zur Rezension - Iudicium Verlag GmbH
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
nalen Stereotypen stehen, auf die sie in<br />
diesem Zusammenhang auch eingeht.<br />
Zumeist sehr komprimiert und informativ<br />
und nur in einzelnen Fällen tiefer in<br />
linguistische Details gehend, läßt sich das<br />
Buch gut lesen. Dies liegt nicht zuletzt<br />
auch an der sprachlichen Ausgewogenheit,<br />
Fachbegriffe werden zwar verwendet,<br />
größtenteils aber auch definiert. Eine<br />
Herausforderung für Studienanfänger<br />
könnte vielleicht der Text von I. M. Kobozeva<br />
darstellen; er ist der einzige englischsprachige<br />
Text des Buches. Kritischer<br />
als die Sprache selbst sei dabei<br />
jedoch die verwendete Abkürzung »NS«<br />
für »National Stereotypes« angemerkt.<br />
Neben der grundsätzlichen Frage, ob<br />
eine Abkürzung dafür überhaupt notwendig<br />
ist, wäre es vielleicht auch eine<br />
Überlegung wert, eine – zumindest für<br />
Leser im deutschen Sprachraum – weniger<br />
belastete Abkürzung zu verwenden.<br />
Irritierend beim Lesen sind an mancher<br />
Stelle die vielen, oft längeren Fußnotentexte.<br />
Es sei jedoch positiv anzumerken,<br />
daß viele der Fußnoten Hinweise auf<br />
Quellen enthalten, denn beim bewußten<br />
Verzicht auf Details wird stets auf Autoren<br />
verwiesen, die sich eingehender mit<br />
einem angesprochenen Aspekt beschäftigen.<br />
Das Buch ließe sich – nicht zuletzt auch<br />
wegen seines Titels – noch in einige<br />
Richtungen, genauer gesagt in einige<br />
Himmelsrichtungen und deren Sprachräume,<br />
ergänzen. »Zu Europas Selbstverständnis<br />
gehört die Vielsprachigkeit,<br />
die angesichts neuer Herausforderungen<br />
immer wieder neu zu gestalten und<br />
zu tradieren ist. Dies braucht staatliche<br />
Garantien – und das Engagement der<br />
Sprecher der Sprachen in Europa.« (9)<br />
Im Sinne dieses Plädoyers wäre es vielleicht<br />
eine Überlegung wert, wie ein<br />
größerer Leserkreis für dieses empfehlenswerte<br />
Buch und sein stets aktuelles<br />
Titelthema gewonnen werden könnte.<br />
219<br />
Miyake, Satoru:<br />
Aufbau der deutschen Sprache. Frankfurt<br />
a. M. u. a.: Lang, 2003. – ISBN 3-631-<br />
51085-3. 173 Seiten, € 39,00<br />
(Richard Hinkel, Lissabon / Portugal)<br />
Auf der Buckrückseite ist der Kurztext<br />
abgedruckt: »Zunächst wird vom Standpunkt<br />
des Sprechers aus als Vorstufe des<br />
Begriffs die Begriffsvorstellung eingeführt,<br />
deren Gleichsetzung mit dem Begriff<br />
Grundlage des Sprechens bildet.<br />
Weitere Grundlage ist, dass die Sprache<br />
keinen Gegenstand hat und der Begriff<br />
kein Bestandteil des Satzes ist.« Wie ist<br />
das zu verstehen? Vorstellung, Begriff<br />
und Laut sind Stufen der Sprachproduktion,<br />
die sich nach dem Gleichsetzungsprinzip<br />
identifizieren und gegenseitig<br />
binden. Während die Vorstellung etwas<br />
Vorübergehendes und Konkretes, Relatives<br />
und Bewußtes ist, ist der Begriff als<br />
Repräsentation der Vorstellung beständig<br />
und abstrakt, allgemein und latent,<br />
gleichzeitig wie ein »Magnet«, der »sich<br />
aufdrängt«, ein »Gedächtnisbild«, ähnlich<br />
Platons idea. Die Vorstellung ist<br />
individuell und »frei«, da nur vom Mitteilungswillen<br />
des Sprechers abhängig,<br />
während der Begriff, der der Vorstellung<br />
»Ordnung verleiht«, kollektiv und in der<br />
Sprache begründet ist. Die gewissermaßen<br />
dazwischenliegende Begriffsvorstellung<br />
macht den (latenten) Begriff bewußt,<br />
während letzterer die Vorstellung<br />
(z. B. ein subjektives Gefühl der Trauer)<br />
zu dem übermittelbaren Wort traurig<br />
objektiviert.<br />
Mehrere Einzelvorstellungen bilden die<br />
Satzvorstellung, mit der Mitteilungsvorstellung<br />
als Rhema. Ebenso unterliegen<br />
die Einzelbegriffe und der Mitteilungsbegriff<br />
der »allgemeinen Regel«, unter der<br />
der Autor so etwas wie Weltwissen und<br />
Logik i. w. S. zusammenfaßt. Die abstrakte<br />
und allgemeine Lautgestalt teilt<br />
der Autor in Laut- und Hörbild, je nach