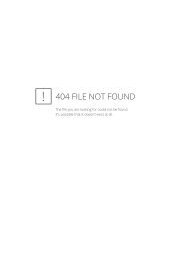zur Rezension - Iudicium Verlag GmbH
zur Rezension - Iudicium Verlag GmbH
zur Rezension - Iudicium Verlag GmbH
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
da der Autor Thema mit Subjekt gleichsetzt!);<br />
»Setzsatz« steht mehrmals mit<br />
unterschiedlicher Definition bzw. kontextueller<br />
Funktion, und was unter »Gebilde«<br />
(als Gegensatz zu »Vorgang«) oder<br />
»allgemeine Regel« genau zu verstehen<br />
ist, kann man nur erraten. Der Leser<br />
dieser <strong>Rezension</strong> möge sich anhand einiger<br />
Auszüge ein eigenes Urteil bilden:<br />
»Die Lautgestalt ist abstrakt und allgemein,<br />
weil es [sic] […] gebildet wird.«<br />
(21); »Es hat jedoch keine Funktion, die<br />
intellektuelle Bedeutung zu unterscheiden.«<br />
(21); »R und L üben keine Unterscheidungsfunktion,<br />
was die intellektuelle<br />
Bedeutung angeht, aus.« (22); »Die<br />
Lautgestalt ist das Lautbild des Begriffs<br />
(oder das Hörbild der Bedeutung) und<br />
wird zum Laut, wenn es [sic] ausgesprochen<br />
wird.« (22); »Der Satz ist keine<br />
Schilderung, sondern die Mitteilung der<br />
Vorstellung.« (23); »Das Thema wird in<br />
der Grammatik das Subjekt genannt.«<br />
(23); »Während im Japanischen dabei<br />
besonders das Thema, d. h. das Subjekt<br />
gewöhnlich ausgelassen wird, nehmen<br />
im Deutschen Thema und Rhema so feste<br />
Formen an, dass sogar das formale Subjekt<br />
gesetzt wird, wie in es regnet […].<br />
Eine Form ohne Subjekt wie es regnet<br />
[…].« (23); »Substantiv« statt Subjekt (26);<br />
»Das Gleiche gilt für Aktiv und Passiv«<br />
[richtiger: Dies gilt gleichfalls für Aktiv<br />
und für Passiv, R. H.] (26); »[…] muss in<br />
der deutschen Sprache das Thema als<br />
Subjekt ausgedrückt werden« (27); »Wie<br />
angeführt, ist im Satz das Rhema […]<br />
Hauptsache und das Thema Nebensache.«<br />
(26, dagegen auf S. 28:) »[…] möchte<br />
der Sprecher den Gegenstand der Handlung<br />
[gemeint ist das Objekt oder Patiens]<br />
hervorheben […]: Das Register ist von<br />
mir ausgearbeitet worden.« »Im Satz der<br />
Zug kam nicht wird die Begriffsvorstellung,<br />
der [sic] dem Lautbild nicht kommen<br />
zugrunde liegt, mit nicht kommen identifiziert.«<br />
(38)<br />
221<br />
Viele Beispielsätze und Ausdrucksmittel<br />
sind ungewöhnlich oder unverständlich:<br />
»Es zuckt, läuft kalt.« (27); »bebaken, -takeln,<br />
-grannt« (119); »beaufschlagen, -gischten,<br />
-kohlen, -harken« (120).<br />
Mit der Behauptung, das Wort müsse<br />
nicht erst Bestandteil des Satzes sein, um<br />
eine »einzige Bedeutung« und einen<br />
»eindeutigen Sinn« zu haben (35), wird<br />
die diskursiv-kontextuelle Bedeutungserschließung<br />
völlig ignoriert.<br />
Dies ist keine leichtfertige Kritik und<br />
bedarf eines Vorbehalts: Ärgerlich ist es<br />
nicht, wenn ein Nichtlinguist über ein<br />
linguistisches Thema schreibt – im Gegenteil:<br />
Außensicht und Distanz zum<br />
sujet lassen oft Dinge sehen, die der<br />
»Fachidiot« nicht mehr sieht, und lebenslange<br />
Erfahrung mit der reflektierten<br />
Praxis des Sprachgebrauchs und Sprachvergleichs<br />
(der Autor ist 70 und von<br />
Beruf Übersetzer) sind zuweilen mehr<br />
wert als einschlägiges Studium und akademische<br />
Elfenbeinturmexistenz. Allerdings<br />
gilt es, gewisse Regeln zu beachten.<br />
Wer Thema mit Subjekt verwechselt, mit<br />
»Wortgruppen« Ableitungen meint (94)<br />
und behauptet, »das Subjekt regiert […]<br />
Objekte« (122), muß damit rechnen, auf<br />
Ablehnung zu stoßen. Da hilft auch die<br />
Entschuldigung des Autors (im Vorwort)<br />
nicht, er habe sich in den 30 Jahren, seit er<br />
sich während seines (Germanistik-)Studiums<br />
in Deutschland mit dem Thema<br />
dieser Arbeit beschäftigt habe, nicht »mit<br />
den neuesten Ergebnissen einer sich stürmisch<br />
entwickelnden germanistischen<br />
Linguistik auseinandersetzen« können.<br />
Ebenso ist es nicht ärgerlich, daß ein<br />
Ausländer nichtdeutscher Muttersprache<br />
(der Autor ist Japaner) über die deutsche<br />
Sprache schreibt – im Gegenteil: Einige<br />
der besten Grammatiken stammen bekanntlich<br />
von Nichtmuttersprachlern,<br />
denn erst aus der Fremdperspektive werden<br />
im Vergleich Phänomene deutlich,<br />
die der Muttersprachler entweder gar