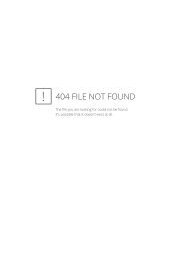zur Rezension - Iudicium Verlag GmbH
zur Rezension - Iudicium Verlag GmbH
zur Rezension - Iudicium Verlag GmbH
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
220<br />
Sprecher- oder Hörerperspektive. Ihre<br />
konkrete und individuelle Aktualisierung<br />
ist der Laut. Der Satz unterliegt dem<br />
Ordnungsprinzip von Thema und<br />
Rhema, das der Autor mit Subjekt und<br />
Prädikat gleichsetzt. Weitere Regeln des<br />
Satzbaus bezeichnet er als »Schema«,<br />
ohne mehr darüber zu sagen.<br />
Der Autor hat damit »linguistische<br />
Grundbegriffe unter die Lupe genommen<br />
und zum Teil einer radikalen Kritik<br />
unterzogen« (Geleitwort von H. W.<br />
Eroms, Seite 7, der auch die Durchsicht<br />
des Manuskripts besorgte). Er möchte<br />
»der wissenschaftlichen Welt <strong>zur</strong> Diskussion<br />
stellen« (Vorwort, 9), wie sich seiner<br />
Meinung nach »das Sprechen herausbildet«<br />
(13), da Sprache »keinen Gegenstand<br />
hat« sondern »vom Bewußtseinsinhalt<br />
ausgeht« (12). Der erste Teil des<br />
Buches (»Aufbau des Satzes«) ist unterteilt<br />
in die Kapitel »Der Gegenstand der<br />
Sprache« (14), »Begriff« (17) und »Allgemeine<br />
Regel« (45). Hier fügt der Autor zu<br />
den Modalitäten Wirklichkeit/Tatsache<br />
und Fiktion (Modi Realis und Irrealis) als<br />
3. Kategorie die Semi-Fiktion (Quasi-<br />
Realis) hinzu, mit der er so unterschiedliche<br />
Dinge wie indirekte Rede, Kausalität,<br />
Finalität, Frage, Ausruf, Befehl u. a. erklärt.<br />
Nach einem »Intermezzo« (71) über<br />
den Gebrauch des bestimmten und unbestimmten<br />
Artikels wird im 2. Teil der<br />
»Aufbau des Wortschatzes« (75) behandelt.<br />
In der Einleitung dazu nimmt der<br />
Autor noch einmal Vorhergehendes über<br />
den Begriff auf (»Eine Sprache lernen<br />
heißt Begriffe kennenlernen«) und leitet<br />
dann zum Prinzip der Kategorisierung<br />
über (Begriffe sammeln, ordnen und Kategorien<br />
als Gedächtnisbilder explizit<br />
machen), was für uns den praktischen<br />
Wert habe, »dass wir die Sprache besser<br />
verstehen und ausdrücken können« (76).<br />
Es folgen seitenlange Listen von Ausdrucksmitteln,<br />
die der Autor nach semantischen,<br />
verbalen (d. h. morphologi-<br />
schen), syntaktischen und situationellen<br />
Kategorien ordnet.<br />
Bei einer ersten Lektüre stellt sich dies allerdings<br />
nicht so klar und verständlich<br />
dar, wie hier skizziert. Beginnen wir deshalb<br />
die Kritik mit dem Negativen. Schon<br />
der pompöse Titel Aufbau der deutschen<br />
Sprache läßt eher eine mehrbändige, wissenschaftlich<br />
fundierte Grammatik erwarten<br />
als ein Büchlein mit knapp 100 Seiten<br />
Text plus Wortlisten. Weder Literaturverzeichnis<br />
noch Schlagwortregister noch ein<br />
hier notwendiges Glossar geben der Veröffentlichung<br />
wenigstens einen wissenschaftlichen<br />
Anstrich. Dazu ist der Preis<br />
für dieses dünne Paperback fast schamlos<br />
zu nennen. In der Diktion ist die eingangs<br />
zitierte Klappentext symptomatisch für<br />
das ganze Buch: Die Anreihung apodiktischer<br />
Aussagen geben dem Diskurs einen<br />
schulmeisterlichen Ton; ungenaue, zuweilen<br />
widersprüchliche Terminologie, logische<br />
Ungereimtheiten, ungelenke Formulierungen<br />
bis hin zu schieren sprachlichen<br />
Fehlern (Lektorierung?), rätselhafte Ausdrücke<br />
und Sätze, die auch nach mehrmaligem<br />
Lesen unverständlich bleiben, eintönige<br />
Wiederholungen (»Wie schon gesagt«,<br />
»Wie oben erwähnt« etc.) und zahlreiche<br />
Behauptungen, denen nicht jeder<br />
Linguist zustimmen wird, machen die<br />
Lektüre nicht zu dem, was man ein Lesevergnügen<br />
nennt.<br />
Vorstellung, Begriffsvorstellung, Begriff<br />
und Begriffsinhalt etc. muß man mal<br />
genau unterscheiden, mal sind sie das<br />
gleiche; mal folgt die Vorstellung dem<br />
Begriff, mal ist es umgekehrt (30–34).<br />
Und obwohl der Autor am Anfang<br />
schreibt, daß »man sich möglichst an die<br />
alltäglichen und eingebürgerten Termini<br />
halten soll«, wird der Leser mit recht<br />
sonderbaren Bezeichnungen konfrontiert:<br />
»Indirektum« (Konjunktiv I), »Position«<br />
(nicht negierter Satz), »Aussagesatz«<br />
(Satz ohne Thema bzw. mit es-<br />
Subjekt, typischerweise alle Passivsätze,