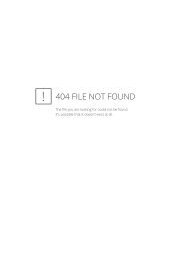zur Rezension - Iudicium Verlag GmbH
zur Rezension - Iudicium Verlag GmbH
zur Rezension - Iudicium Verlag GmbH
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
172<br />
stellen und gleichzeitig einzelne Aspekte<br />
herauszugreifen. Bezeichnend ist z. B.,<br />
daß die Relativpronomen im Kapitel zu<br />
den Pronomen (»Sich einrichten«, 42–55)<br />
zwar erwähnt werden, ausführlich behandelt<br />
werden sie jedoch unter »Nebensatz<br />
als Relativsatz« (»Dinge, die wir<br />
lieben«, 172) im Kapitel »Satzgefüge aus<br />
Hauptsatz und Nebensatz« (»Wenn Sofas<br />
reden könnten…«, 162–174). Gewährleistet<br />
wird dieser Gesamtzusammenhang<br />
nicht zuletzt durch sehr gut ausgewählte,<br />
kurze authentische (Zeitungs-)Texte, die<br />
ein Kapitel jeweils einleiten und ihm<br />
einen kontextuellen Rahmen geben.<br />
Ein separater Übungsteil (mit Lösungsschlüssel)<br />
ist im Umfang so gehalten, daß<br />
er niemanden erschlägt und durch entsprechende<br />
»Tipps zum Allein-Üben«<br />
zum Selbststudium ermuntert. Allerdings<br />
könnten diese Tips weiter ausgebaut<br />
sein. Die Übungsaufgaben selber<br />
sind zwar einerseits inhaltlich motivierend<br />
und anregend (vgl. z. B. Aufgabe V,<br />
3 auf S. 199: »Die seltenste Zahl, die beim<br />
Samstags-Lotto gezogen wird, ist die<br />
Zahl a) 13 b) 20 c) 31.«). Auf der anderen<br />
Seite handelt es sich vorwiegend um<br />
beliebige Einzelsätze, die lediglich durch<br />
das grammatische Phänomen zusammengehalten<br />
werden. Der meist fehlende<br />
Kontextbezug steht im Widerspruch zum<br />
Hauptteil.<br />
Ausgesprochen schade, wenn nicht gar<br />
ärgerlich, ist auch, daß das Layout so<br />
wenig ansprechend gestaltet ist: Die<br />
Schrift ist zu klein, alles wirkt ineinander<br />
gedrängt und die vielen Hervorhebungen<br />
schaffen keine übersichtliche Struktur.<br />
Außerdem fehlen gänzlich konkrete,<br />
weiterführende Literaturangaben. Ausnahmen<br />
sind lediglich Textquellen direkt<br />
zitierter Literatur und pauschale Hinweise<br />
auf Wörterbücher (228). Es versteht<br />
sich von selbst, daß die einzelnen Grammatikphänomene<br />
in einem Rahmen, wie<br />
er in Grammatik (noch mal) von Anfang an<br />
gegeben ist, in ihrer gesamten Ausführlichkeit<br />
weder diskutiert werden können<br />
noch sollen. Entsprechend zu allgemein<br />
und wenig hilfreich ist dann ein Verweis<br />
wie: »Diejenigen, die über den angebotenen<br />
Umfang hinaus intensiveres Üben zu<br />
Phonetik, Orthographie, einzelnen<br />
Grammatikthemen oder Text wünschen,<br />
finden auf dem Markt spezielle Übungsbücher<br />
oder andere Lehrmittel zu den<br />
einzelnen Themen.« (3)<br />
Enttäuschend ist des weiteren der einleitende<br />
Teil »Über die deutsche Sprache«,<br />
der auf Aspekte wie Ausdrucksvarianten<br />
(»Geld oder Knete?«, 7), Herkunft und<br />
Entstehen von Wörtern (»Wolkenkratzer<br />
und Handys«, 9–11), in erster Linie aber –<br />
und m. W. als erste Grammatik überhaupt<br />
– auf die nationalen (»Erbsli, Karfiol<br />
und Blumenkohl«, 5) und regionalen<br />
(»Semmeln und Schrippen«, 6) Varietäten<br />
der deutschen Sprache eingeht.<br />
Gerade letztere Kapitel scheinen mit heißer<br />
Nadel gestrickt und sind entsprechend<br />
unpräzise und voller Fehler, wodurch<br />
sie wenig <strong>zur</strong> Klärung beitragen –<br />
im Gegenteil! Davon zeugen bereits die<br />
als Standardvariante angeführten<br />
schweizerischen Erbsli in der Überschrift,<br />
die aber der Mundart (anders gesagt dem<br />
Schwyzertütschen bzw. Schweizerdeutschen)<br />
zugerechnet werden müssen,<br />
während andere Beispiele wie Dörfle,<br />
Bubli (5, letzteres noch einmal S. 32) nicht<br />
einmal hierzu gehören. Aber nicht nur<br />
die Beispiele sind etwas unglücklich gewählt<br />
(z. B. Telefonhütteln für Österreich<br />
und Telefonhäuschen für Deutschland,<br />
während die nationale Variante für<br />
Deutschland und Österreich Telefonzelle<br />
wäre, im Unterschied <strong>zur</strong> deutschschweizerischen<br />
Telefonkabine; vgl. hierzu das<br />
Variantenwörterbuch des Deutschen, 2004).<br />
Auch grundlegende Informationen sind<br />
zu pauschal oder gar falsch, wie z. B.<br />
folgende Aussage: »Die meisten Gemeinsamkeiten<br />
haben übrigens die norddeut-