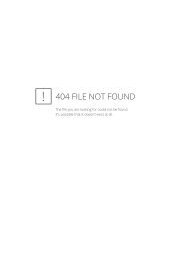zur Rezension - Iudicium Verlag GmbH
zur Rezension - Iudicium Verlag GmbH
zur Rezension - Iudicium Verlag GmbH
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
244<br />
rierendes Nachwort und somit auch irgendein<br />
(und sei es nur historische Übergänge<br />
und Brüche verdeutlichender) Verweisungszusammenhang<br />
der doch sehr<br />
unterschiedlichen Phänomene.<br />
Die germanistische Mediengeschichte beginnt<br />
hier mit der Zeit um 800. So deutet<br />
Ulrich Ernst die Kreuzgedichte des Hrabanus<br />
Maurus als ein für die Folgezeit<br />
singuläres »multimediales Kunstwerk«,<br />
in dem die »Verschaltung lingualer, pikturaler<br />
und numerischer Codes« auf die<br />
höhere Bedeutungsebene der göttlichen<br />
Weltordnung hinweist (37). Danach werden<br />
Einzelaspekte aus zwei mittelalterlichen<br />
Epen behandelt: Haiko Wandhoff<br />
sieht die Schilderung von Bild- und<br />
Bauwerken in Chretiens de Troyes Erec et<br />
Eneide als »räumlich-plastische Formen<br />
der Informationsspeicherung und -verarbeitung«,<br />
wie sie für die »Arbeitsweise<br />
des menschliches Gedächtnisses« bei allen<br />
»medialen Verräumlichungsstrategien«<br />
damals wie heute »offenbar grundlegend«<br />
seien (55), und Christina Lechtermann<br />
zeigt in einer Willehalm-Szene,<br />
daß Wolfram von Eschenbach nicht nur<br />
den Blick der Königstochter Alise und<br />
ihren Anblick beschreibt, sondern sich<br />
selbst als faszinierten Beobachter zu erkennen<br />
gibt und somit zum faszinierenden<br />
»Überträger von Affekten für den<br />
Rezipienten« wird (111). Die bisherigen<br />
Analysen finden in Norbert Otts Beitrag<br />
gewissermaßen eine für diese Epoche<br />
allgemeingültige Schlußfolgerung; denn<br />
in den zitierten Bildhandschriften und<br />
Inkunabeln gibt es weder eine Priorität<br />
des Textes noch des Bildes, was schon die<br />
ausgezeichnet wiedergegebenen Bildbeispiele<br />
beweisen können, sondern gerade<br />
erst durch das »Zusammenwirken beider<br />
Medien wurde im Mittelalter Welt erkannt,<br />
beschrieben und interpretiert«<br />
(76).<br />
In den drei folgenden Analysen versuchen<br />
die Autoren, die Medienumbrüche vom<br />
Anfang bis zum (problematisierten) Ende<br />
der Gutenberg-Galaxis an äußerst spezifischen<br />
Aspekten zu skizzieren. Horst Wenzel<br />
verfolgt die Handgebärde als wechselndes<br />
Zeichen der Kommunikation vom<br />
frühen Flugblatt bis zum digitalen Medium,<br />
wobei die Relation von Text und<br />
Hypertext das verbindende Kriterium<br />
bleibt. Jürgen Fröhlich liefert eine kurze<br />
Kulturgeschichte der Zahl Null, indem er<br />
die Unterschiedlichkeit ihrer materiellmedialen<br />
Träger an der Verschiedenheit<br />
ihres merkantilen, mathematischen und<br />
symbolischen Diskurses festmacht. Und<br />
Angelika Storrer und Eva Lia Wyss weisen<br />
nach, daß die Pfeilzeichen → im Laufe<br />
ihrer Geschichte immer komplexere, vielförmigere<br />
und vieldeutigere (und damit<br />
auch mißverständlichere) Metamorphosen<br />
durchlaufen haben.<br />
Die fünf übrigen Beiträge beschäftigen<br />
sich mit Phänomenen des letzten Jahrhunderts.<br />
Kritisch setzen sich Hermann Cölfen<br />
und Werner Holly mit dem Fernsehen<br />
auseinander, das nach ihrer Meinung immer<br />
mehr zu einer »Trivialisierung« des<br />
Bewußtseins tendiere (212, 238); der eine<br />
zeigt den »Verlust der Sprache im Spektakel<br />
der Talkshows« auf, und der andere<br />
wendet sich einem »Fernsehjahrhundertrückblick«<br />
zu, in dem folgenreiche historische<br />
Fakten collageartig aneinandergereiht<br />
und zu medialen Geschichtsklischees<br />
verkürzt werden. Ulrich Schmitz<br />
untersucht sodann die zahlreichen Text-<br />
Bild-Metamorphosen im modernen Medienalltag<br />
und stellt dabei eine Homologie<br />
zwischen den immer komplexeren modernen<br />
Lebensverhältnissen und den immer<br />
vielfältigeren symbiotischen Verbindungen<br />
von Texten und Bildern fest; darauf<br />
ist jedoch, wie er völlig zu Recht anmerkt,<br />
»weder unsere Wissenschaft noch<br />
unser Bildungssystem […] hinreichend<br />
eingerichtet« (258 f.). Nach Elisabeth<br />
Cölfens Bericht über ein konkretes hypermediales<br />
Projekt, mit dem sich zum Bei-