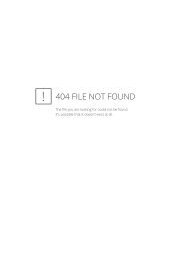zur Rezension - Iudicium Verlag GmbH
zur Rezension - Iudicium Verlag GmbH
zur Rezension - Iudicium Verlag GmbH
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
222<br />
nicht identifiziert oder aber umständlich<br />
erklären muß, was in einer anderen<br />
Sprache eine einfache Entsprechung hat.<br />
Ärgerlich ist es aber, wenn unvollkommene<br />
Sprachbeherrschung das Verstehen<br />
so erschwert, daß die Lektüre durch<br />
ständiges Nachlesen recht ermüdend<br />
wird.<br />
Dies alles schmälert natürlich den Wert<br />
des Buches, und das ist schade, weil<br />
vieles gut durchdacht ist und auf tiefen<br />
Einsichten gründet, auch wenn wegen<br />
der Perspektivierung aus japanischer<br />
Sicht für den deutschen Leser vieles fehlt<br />
und anderes dafür überinterpretiert<br />
scheint. Die Herausbildung des Sprechens<br />
von der Vorstellung aus ist gut<br />
nachvollziehbar. Interessant auch die<br />
These, daß in Negation, Ergänzungsfrage<br />
u. a. nicht der ganze Satz verneint ist,<br />
sondern nur ein Satzteil. Die gleiche<br />
Erklärung kann man übrigens für gewisse<br />
Irrealis-Sätze ansetzen (die der<br />
Autor unter dem Titel »Widerspruch«<br />
leider als interpretierende Wertungen erklärt):<br />
Warum sagen wir etwa Fast wäre<br />
ein Unfall passiert – wenn noch fast hier so<br />
viel wie nicht bedeutet und die Satzaussage<br />
also der Realität entspricht (in anderen<br />
Sprachen deshalb meist im Indikativ!).<br />
Auch die Bedeutung des Kategorisierens<br />
beim Lernen einer Fremdsprache<br />
ist gerade für DaF-Lehrer ein wichtiger<br />
Gesichtspunkt. Schließlich ist die kategorisierte<br />
Inventarisierung von Ausdrucksmitteln<br />
eine Fundgrube für Lerner, Lehrer,<br />
Lehrbuchautoren und Linguisten; allein<br />
die Verben mit dem Präfix be-,<br />
unterteilt in Gruppen mit ähnlicher/m<br />
Bedeutung/Gebrauch, füllen 20 Seiten.<br />
Der Theorieteil dagegen dürfte für<br />
Deutschlehrer und -lerner – solche mit<br />
japanischer Ausgangssprache ausgenommen<br />
– von geringerem Interesse sein;<br />
hier kommen eher linguistisch, insbesondere<br />
sprachphilosophisch interessierte<br />
Leser auf ihre Kosten.<br />
Neuhaus, Stefan:<br />
Grundriss der Literaturwissenschaft.<br />
Tübingen: Francke, 2003 (UTB 2477). –<br />
ISBN 3-8252-2477-5. 250 Seiten, € 13,90<br />
(Werner Heidermann, Florianópolis / Brasilien)<br />
An Überblicken über, Einführungen in<br />
und Hinführungen zu mangelt es nicht,<br />
gerade in der Literaturwissenschaft.<br />
Wenn dann noch ein Grundriß hinzukommt,<br />
fragt sich, was es Neues gibt.<br />
Stefan Neuhaus will »schwierige Sachverhalte<br />
auf einfache und möglichst unterhaltsame<br />
Weise darstellen« (XIII); das<br />
ist verdienstvoll, aber natürlich nicht neu.<br />
Jedes Sachbuch unternimmt genau diesen<br />
Versuch: die Transformation von<br />
Komplexem in Verständliches. Die<br />
Schwierigkeit hierbei ist oft, den Grad<br />
der didaktischen Reduktion durchzuhalten,<br />
einen einmal definierten Erklärungsduktus<br />
beizubehalten, beim Komplexen<br />
nicht simpel zu werden und beim Einfachen<br />
nicht redundant.<br />
Die »Freude an der Literatur« ist das<br />
Programm, und Stefan Neuhaus wird<br />
diesem Anspruch sehr gut gerecht. Der<br />
Titel richtet sich an Studienanfänger,<br />
und die werden das Buch mit Gewinn<br />
lesen. Nur an wenigen Stellen ist es zu<br />
Überreduzierungen gekommen, etwa<br />
hier: »Eine wiedergegebene Unterhaltung<br />
nennt man Dialog – im Gegensatz<br />
zum Monolog, wenn nur einer redet.«<br />
(34) Wer das nicht weiß, der weiß auch<br />
nicht, daß eine Buchhandlung ein Laden<br />
ist, in dem man Bücher kaufen kann, im<br />
Gegensatz zu einer Bibliothek, in der<br />
man Bücher leiht. An wenigen – aber<br />
störenden – Stellen führt der sich selbst<br />
auferlegte Unterhaltungszwang zu Albernheiten;<br />
so werden im Kapitel »Rezeptionsästhetik«<br />
Iser und Jauß vorgestellt,<br />
und es wird Isers »Begriff der<br />
Leerstelle« in einer Zeile erläutert. Was